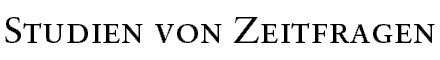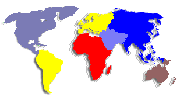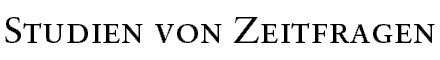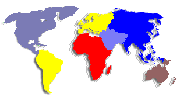|
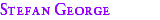
4.
Am streit wie ihr ihn fühlt nehm ich nicht teil.
Wer die politischen Anschauungen Dantes erfassen will, ist insofern stofflich begünstigt, als der Dichter sich nicht nur in der
Commedia über Vergangenheit und Gegenwart seiner Stadt und seines Volkes Rechenschaft gegeben, sondern auch noch in einer systematischen Schrift sein politisches Credo niedergelegt hat.
George, der „Dichter in Zeiten der Wirren“, hatte nicht geringere Anlage zum Staatsmann als der Florentiner. Aber inmitten einer verkommenen Staatenwelt, einer zerbrechenden Gesellschaft und
eines durch viele Gifte verseuchten Volkes mußte er erst Seinen Menschen, Seinen Bund, Seinen Staat schaffen, ehe irgend ein Wirken in größerem Raum sinnvoll war. Darum ist, – so stark sich
Menschen und Ereignisse seiner Zeit in seinen Werken widerspiegeln,– dennoch die Zeitferne Georges weit größer als die Dantes.
Es ist aber ein allgemeines menschliches Anliegen, von dem auch das Jünger-Sein nicht immer enthebt: Antwort zu begehren auf
drängende Fragen des Tages. Noch wo die Antwort verweigert wird, sucht oft der Frager durch Deutung der Weigerung oder durch Auslegen von Worten andren Sinns sich beruhigenden
Ersatz zu schaffen. Hierfür hat wohl seit den Zeiten der Propheten und der Evangelisten kein Werk solch innere Möglichkeit geboten wie Georges Gedichte. Da ihrer viele zugleich hell und dunkel sind
wie alle heiligen Schriften, da ihrer viele durchweht sind „von einer luft erfüllt mit profeten-musik“, haben schon in diesen ersten Jahrzehnten ihrer Wirkung die Deutungen und Fehldeutungen –
drinnen und draußen –, sich in einem Maße gehäuft, daß eine Besinnung auf den staatlichen und eben darum unpolitischen Kern der Dichtung immer wieder not tat und tut. George selbst hat
bisweilen gelacht, bisweilen gezürnt, wenn man ihn mit irgendwelchen ismen in Verbindung brachte. Idealism, Materialism, Nationalism, Patriotism, selbst Symbolism, – all diese Worte und
Begriffe erschienen ihm als armseliger Plunder, erfunden um eigene Gedanken zu verhindern, echte Gefühle zu ersticken und jedenfalls den offenen Blick auf die Dichtung und den Weg zum
Dichter zu versperren.
Nur wenn diese grundlegende Tatsache erkannt ist und festgehalten wird, ist es erlaubt und förderlich, auch über Georges Stellung zum zeitpolitischen Geschehen nachzudenken. Manches
Licht fällt hierdurch auf die jüngste Geschichte, aber auch mancher Zug Georges mag hierdurch deutlich werden, den Gundolf wie Wolters von ihrem Blickpunkt aus vielleicht weniger oder anders
wichtig nahmen als manche der Jüngeren.
Freunde haben erzählt, daß sie, in langjährigem Leben mit dem Meister, nie ein politisches Wort von ihm vernahmen. Diese
Erinnerung ist sicherlich richtig und für alle Zukunft beachtlich. Sie besagt eindeutig, daß der adlige Mensch, die hohe Dichtung und die schöne Kunst nicht nur in Georges Reich des Geistes, sondern
auch im täglichen Leben und im freundschaftlichen Gespräch die Mitte bildeten, und je stärker dichterisch bewegt und bewegbar der Freund, umso mehr hat daher George auch das Gespräch nur
um das Höchste kreisen lassen. Aber es ist wohl auch bemerkenswert, daß solche Erinnerungen vornehmlich Jahre vor dem ersten Weltkrieg überdecken. Denn je gewaltiger das
Sehertum Georges sich entfaltete, umso gewichtiger wurde das „Zeitgedicht“, das heißt aber auch: der Dichter in seiner Zeit.
„Wenn wir von den schändlichen einflüssen des Preußentums reden so weiß jeder verständige daß wir uns gegen keine person – nicht einmal gegen einen volksstaman richten sondern gegen
ein allerdings sehr wirksames aber aller kunst und kultur feindliches System.” Dieser Satz steht unter der Überschrift „Preußentum“ im Eingang der fünften Folge der „Blätter für die
Kunst”. Er ist veröffentlicht im Jahre 1901, als das kaiserliche Deutschland, dessen Barbarentum und Kulturfeindschaft schon Merksprüche früherer Folgen angeprangert hatten, auf der Höhe
seiner Macht stand. Es ist die gleiche Folge, in welcher dem Deutschen die Mahnung vorgehalten wird, daß ihm „endlich einmal eine geste: die Deutsche geste“ zu bekommen, wichtiger ist als
zehn eroberte Provinzen. Und schließlich die gleiche Folge, in welcher in Worten, die an Goethe und – hierin verbunden – an Burckhardt und Nietzsche gemahnen, der „Vorzug der
Kleinstaaten“ - gerühmt wird: Ihnen wird es leichter möglich geistige Werte auszubilden als den großen die in beständiger äußerer und innerer abwehr nie dazu die ruhe erlangen“.
Diese drei Merksprüche sind in den ersten Auswahlband der „Blätter“, der sich an eine breitere Öffentlichkeit wandte, unverändert aufgenommen. Sie zeigen deutlich, daß allein die
Sorge um Geist und Haltung der Deutschen auch in politischen Fiagen das Ja und das Nein der Dichter bestimmte. Und sie beleuchten eine wesentliche Richtung, in der Georges Erziehung
vor dem ersten Weltkrieg wirksam wurde. Dabei entsprang in George selbst das Lob des Kleinstaates vielleicht sogar weniger gedanklicher Überzeugung als einem ursprünglichen,
landsmannschaftlich und dynastisch gefärbten Gefühl. Die gleiche Verwurzelung im heimatlichen Boden, die ihn die von der Rheinpfalz bis zur Nahe gebräuchliche Mundart festhalten und
gegenüber preußischen Fexen mit besonderem, breitem Behagen sprechen ließ, band ihn an seinen Kleinstaat Hessen und an seinen Großherzog Ernst Ludwig. So oft er betonte, daß in keinem
der regierenden Fürsten echtes Herrschertum zu finden sei, so verzeichnete er es doch mit Genugtuung, daß sein Großherzog und die Wittelsbacher Prinzen „besser aussahen” als die
kulturlosen Hohenzollern und insonderheit der kaiserliche Popanz, – „spotthafte Könige mit Bühnenkronen“.
Daher hatte er auch sichtliches Vergnügen an Hellingraths knorrigem Bajuvarentum und freute sich über den Frankfurter
Stadt-Stolz, – immer so lange, als nicht das Kleinstaatliche aufs Geistige übergriff und dort mit der Gefahr einer öden Provinzlerei drohte. Schon als Hellingrath einmal von Hofmannsthal als
österreichischem Dichter sprach, gab es einen Verweis. Als gar einmal Gundolf und Salin ihre Lokaldichter rühmten, Gundolf den Darmstädter Niebergall, Salin die Frankfurter Malss und Stoltze,
wurde der Zwist schnell durch bissigen Hohn geschlichtet: „Habt Ihr noch keine mathematische Formel für dichterische Größe? Wie wärs mit dieser: Shakespeare verhält sich zu Niebergall wie die
Welt zu Darmstadt und wie König Lear zum Datterich ..“
Auch das Anti-Preußentum entbehrte nicht der gefühlsmäßigen Elemente. Die Ereignisse von 1914 bis 1939 haben die Tatsache, daß es bis anhin in Deutschland als innere Grenze die
Rhein-Main-Linie gegeben hatte, stark in Vergessenheit geraten lassen, – aber sie war doch eine Wirklichkeit von außerordentlicher Kraft, die einer frühen preußischen
Uniformierung des Kaiserreichs mehr Hindernisse entgegenstellte als die unerheblichen Machtbefugnisse der süddeutschen Bundesstaaten. Jedenfalls: George fühlte sich als Franke, als Sohn
der deutschen Mittellande und ihres kulturverbundensten Stammes, und so war ihm der Preuße als der geistloseste Vertreter der „hellhaarigen schar” tief verdächtig. Aber wichtiger
als die gefühlsmäßigen Gegensätze waren doch die rüstigen Bedenken, die die Betrachtung von Vergangenheit und Gegenwart noch nährte und verstärkte.
Durch Verwey’s Erinnerungen ist bekannt geworden, daß George um die Jahrhundert-Wende ein großes Rhein-Epos plante, das „all
sein deutsches Fühlen und Trachten“ vereinigen sollte. Wie weit dies Epos gedieh, ist nicht be kannt. In „Der siebente Ring sind daraus sechs Einzelstrophen „Rhein“ veröffentlicht, deren letzte
oft angeführt wird, um die George eigene, die südliche, die römische Deutschheit zu kennzeichnen. Aber, verhüllt und darum unbeachtet, ist in der vierten Strophe auch ihr Gegensatz
genannt: der ekle „schutt von rötel, kalk und teer“, – rot weiß schwarz – schwarz weiß rot – die Farben des Bismarckschen Reiches. Auf die Frage, ob dies die richtige Deutung der Worte sei,
gab der Meister – wie oftmals – die offene Antwort: „So kann man die Verse verstehen”.
Vielleicht entstand im gleichen Zusammenhang ein Zeitgedicht „Der Preuße”. George hat es in Berlin vor einem großen Kreise vorgelesen, aber nicht in die Reihe der „Zeitgedichte”
aufgenommen. Es ist nicht zu wissen, ob neben Dante und Goethe, neben Nietzsche und Böcklin, neben Leo XIII. und den wittelsbachischen Schwestern ihm der Name Bismarcks zu gering,
neben „Franken“ ihm „Der Preuße“ als zu ungewichtig erschien, – das Gedicht ist nie veröffentlicht worden. In den Heidelberger Jahren citierte George, wenn ihm preußischer Assessoren- oder
Kasernenhof-Ton, das leere Geknarr blecherner Stimmen, zu Ohren kam oder wenn ihn eine besondere Redeblüte des Zollernkaisers ergötzt hatte, stattdessen einen Vers aus dem
Gundolfschen Bilderbuch, das er im Anschluß an jene Vorlesung in kleinem Kreise der Jünger wie ein lösendes Satyrspiel hatte vortragen lassen: „Ersäufe, – säufe dieses Preußen ..“
An dieser geistigen Haltung des Dichters hat der Weltkrieg nichts ändern können, – seine Sendung war nicht von äußeren Ereignissen bestimmbar; auch wenn diese seine zeitliche Aufgabe
wechselnd erleichterten oder erschwerten. Selbst die Gefahren, die ihm und seinen Freunden und kleinem Staate drohten, waren im stickigen Frieden nicht kleiner gewesen als jetzt im
mörderischen Krieg, Seine Thränen hatte er vorweggeweint, – er, nicht zu „pressen von der äußern wucht“ ..
Am streit wie ihr ihn fühlt nehm ich nicht teil
Diese Worte richten sich an das deutsche Volk. Aber nicht wenige Jünger mußten sich mitbetroffen fühlen. Denn anders als der
Meister, der in sehr kühlen Worten wohl die rettende Leistung des deutschen Heerführers im Osten anerkannte, sonst aber aus dem Abstand des Sehers Tugend und Tücke bei Freund und Feind in
gleichen Maaßen fand, standen wir Jüngeren zu stark unter dem Eindruck der äußern Bedrohung, und das Gefühl, daß eine deutsche Niederlage auch den meisterlichen Staat gefährden
könne, ließ ihnen allzuleicht – wenn auch meist nur für kurze Dauer – die Verteidigung des kaiserlichen Reichs zusammenschmelzen mit dem schwereren Kampf um das höhere
Deutschtum, zu dem George rief und kor und führte. Und: in dem gemeinsamen Schauer, der in den ersten Kriegswochen das ganze Volk ergriff, glaubten Viele bereits: das Morden, das nun
begann, sei der vom Meister für eine ferne Zukunft im „Stern“ geweissagte Heilige Krieg .. Selbst von dem Ältesten berichtete Hellingrath (Brief vom 12. 8. 1914.): „Karl wütet herum, ob er nicht
doch an die Front kommen könne“. Das Wort Georges hat hier das Gleichgewicht schnell wiederhergestellt, doch habe George zugefügt: „Nur wenn die gelben Affen kommen, dann nehme ich selbst die Flinte”.
Weniger gefährlich als solche Grenzverwischungen waren die politischen Träume der nicht in den Begeisterungs-Strudel Gerissenen. Auch sie haben die geistigen Hoffnungen zu hoch
gespannt und Möglichkeiten später Zukunft schon bald verwirklichbar geglaubt. Aber ihr politisches Gedankenspiel verließ nicht die geistige Linie, die bis anhin beschritten war. So träumten
sie von einer Vernichtung des verhaßten Preußen-Reichs und einem neuen Rheinbund, an dessen Spitze der Dichter-Herrscher treten solle. „Was den Rheinbund anlangt“, schreibt (Brief vom 6.
8. 1914.) schon in den ersten Kriegstagen Hellingrath, „steht mein Haber hoch und in Blüte. Ich bereite das Hölderlinische Deutschland vor in dem gewaltigen Kleinstaaten-Bund der Mitte,
ich freu mich aufs Königreich Polen mit irgend einem Vetter auf dem Thron und hab als neuestes die Erneuerung von Polnisch-Lothringen erfunden (alles drei in Personal-Union mit
Hessen-Darmstadt, meiner alten Welthauptstadt). Aus Östreich das ich doch opfern muß, mach ich so viel Staaten, daß schließlich in dem ganzen Orchester Preußen ein recht bescheidenes
Instrumentchen spielt.“
Der Vetter auf dem polnischen Thron, – das war wieder ein Privatschnörkel des Erben der Cantacuzène. Aber die Rheinbund-Träume spannen sich von München über Heidelberg
nach Berlin. Wer so träumen und doch im allgemeinen Krieg sein Leben einsetzen und opfern konnte, der zog wahrhaft nach des Meisters Wort „um keinen namen – nein um sich“, und – dürfen
wir hinzufügen – der kämpfte und starb nicht für das kaiserliche, sondern für des Meisters Geheimes Deutschland. Dann aber unterschied sich dieser Tod vor dem Feind in Nichts und hatte
keinen Vorzug vor dem Opfertod in der Heimat. Mit seinen Getreuen verabscheute George alles Gerede von Heldenkampf und Heldentod und seine Toten-Tafeln gelten daher den im Feld
Gefallenen nicht anders als dem Dichter, der daheim frei in den Tod ging, und als dem Freundespaar, das dem sinnlosen Schlachtentod vorzog, durch eigne Hand zu sterben.
Es ist aus einigen früher geschilderten Begegnungen ersichtlich, wie George im Gespräch nicht anders als im Gedicht seine am
Krieg beteiligten und bisweilen von Kampf oder Kameradschaft mitgerissenen Freunde auf den gemeinsamen Boden wies oder – wenn nötig – hob. Hinzugefügt sei hier, da es einen wichtigen
Wesenszug des Dichtens verdeutlicht, daß er es nicht nur ablehnte, sondern verargte, wenn man verallgemeinernd etwas Negatives von „den” Franzosen oder „den“ Russen sagte. Der
Verfasser berichtete einmal vom Vormarsch nach Suwalki und Augustowo und ließ dabei eine Bemerkung über die Kulturlosigkeit der Polen fallen. Der Meister fuhr auf, – die Zigarette, die er
zwischen drittem und viertem Finger hielt, zitterte wie eine Peitsche in seiner Hand: „Was ist das für ein alberner Schnickschnack! Mein Freund Waclaw allein reicht aus, um Ihre
Phrase zu entlarven. Hätte ich unter Deutschen so viel natürlichen Adel gefunden wie unter Polen und Spaniern, dann müßte ich mir nicht solche Mühe geben, um Euch zu erziehen.“
So wenig wie der Ausbruch und der Verlauf des Krieges, so wenig konnte sein Ende die Haltung des Dichters verändern.
„Anders als IHR euch geträumt fielen die würfel des streits“, sagt er in den „Einem jungen Führer im ersten Weltkrieg“ gewidmeten Versen. Ihm selbst war nichts Unerwartetes geschehen, und er
allein wußte in jenen Jahren, die von Friedensreden troffen, daß nur der erste Weltbrand vorüber war. Sein inneres Auge sieht weiter zum zweiten und dritten und letzten, dem heiligen,
heilenden Brand, an dessen Ende wieder Frühwind weht und die Königsstandarte mit wahrhaftigem Zeichen flattert... Und wo die Ungeduld seiner aus dem Feld heimkehrenden Jugend wieder
Weissagungen mißversteht und in naher Frist ihr Eintreffen erwartet, da warnt er davor, den Schleier der Zukunft zu lüften, oder spricht es auch ausdrücklich aus, daß es sehr ferne Zeiten
sind, in welche seine Gesichte weisen.
Aber wie er auf wissenschaftlichem Gebiet die Jünger gewähren ließ und läßt, wenn sie hier ihre Ausdrucksform erblicken, so führt
nun die gesteigerte Teilnahme – besonders der Jüngsten – am politischen Geschehen dazu, daß auch auf dieser Ebene einige seiner Getreuen in den Kampf eingreifen. Ihr Ziel ist, wie vor dem
Krieg bei den Älteren, dem lebendigen Geist den Atemraum zu erstreiten. Doch anders als früher ist nun der Hauptfeind nicht das kulturwidrige „Preußentum“, dessen Gefahren für einige Zeit
zurücktreten, sondern jene quallige Würdelosigkeit, welche im Gefolge der Niederlage sich im deutschen Volk verbreitet. Es sind die Jahre, die „Karl Wolfskehls Nova Apokalypsis“ schildert, – die
Jahre, in denen der Widerchrist des Siebenten Rings zu erscheinen verschmäht und Beelzebub, dem Gott des Geziefers, die Herrschaft überläßt, – die Jahre, da jedes Gefühl der Ehre den
Deutschen in feigem Erschlaffen verloren scheint. Der Kampf muß sich daher zuvorderst nach innen richten, wo es gilt, die Deutschen zu mannhaftem Ertragen ihres Schicksals wach zu
rütteln, ihre Neigung zu List und Lüge als Rettungsmitteln zu zerstören und ihnen den Glauben an den Lenker und an die Notwendigkeit des Sühners zu wecken und zu stärken. Aber der
Kampf richtet sich auch nach außen, – „vorm Herrn gilt gleich der in- und aussen-krieg”, sagt der Dichter nicht nur zu Wolters –; denn die moderne Welt des europäischen Bürgertums, die so
lange George im preußisch-deutschen Zerfall am unmittelbarsten entgegengetreten war, ihn innerlich am tiefsten berührt und darum seine schärfste Verdammung erfahren hatte, fühlte nun in
ihrem außerdeutschen Bestand sich nicht nur gesichert, sondern auf Grund ihres Sieges zu einem Schuldurteil über die Deutschen berechtigt. Als Hüter der Heiligen Ehre mußte der deutsche
Dichter, der mitten im Krieg in Jahren eines falschen Patriotismus und einer patriotischen Censur – jedes Schwärmen „von heimischer tugend und von welscher tücke“ weit von sich
gewiesen hatte, nun lodernd ergrimmen, als die Tücke der Sieger im Tugendgewande daher schritt und von den Unterlegenen ein Schuldgeständnis erpreßte.
Während dieser Spanne, für die hier der Name „Versailles“ stehen mag, hat George harte Worte über einzelne Franzosen und über das französische Volk gesprochen, wie er sie während
des Kriegs uns tadelnd verwehrt hätte, – Worte, in deren Bitterkeit oft seine enttäuschte Franken-Liebe mitklang. Und doch ist nicht nur dies allein von Bedeutung, daß nichts derart
Zeitbedingtes in sein Werk einging, sondern selbst im Gespräch folgte auf einen leidenschaftlichen Ausbruch immer eine Hinwendung, eine Hinlenkung auf den allgemeinen Urgrund seiner
Verdammung wie seines Lobs. So zürnte er ein Mal (29. Juni 1920.): „Diese Franzosen müssen ausgerottet werden“. Aber nach einer langen Pause fuhr er fort, mit anderer Stimme, wie aus
einem andern Bereich: „Haben Sie darüber nachgedacht, welche barbarischen oder teuflischen Werkzeuge sich das Schicksal meistens aussucht, um sein Urteil zu vollziehen?“
In die erste Zeit dieses neuen Kampfes nach innen und außen fällt die Trennung von Verwey. Sie beleuchtet auf der Freundes-Ebene den „Streit“, wie ihn George fühlte,– sie allein
darf, da fünf Gedichte von ihr Kunde geben, herangezogen und gedeutet werden, wenn die staatliche und politische Haltung Georges nach dem ersten Weltkrieg erfaßt werden will. Schon die
Vielzahl der kleinen Verse zeigt, wie stark diese Auseinandersetzung George berührt hat, – wer in jenen Jahren mit ihm lebte, vermag dazu noch zu berichten, wie oft er das
Gespräch auf Verwey lenkte, gleichsam als wolle er verhindern, daß die Abschieds-Gedichte als Verdict aufgefaßt würden. Es war sonst nicht Georges Art, zu uns Jüngeren über Freunde zu
sprechen, die wir nicht kannten. Über Verwey war es anders. Es war der Mensch Verwey, der es George angetan hatte und von dem er gern und heiter erzählte, und es war offenbar auch seine
holländische Umgebung, in der er sich wohl fühlte. Die Binnenlandschaft mit ihren „brückchen hügelchen kanälchen“ hatte gewiß keine Züge der Größe und Weite, wie George sie
liebte. Aber das Meer, das Nordmeer mit seinen Dünen war ihm durch Verwey vertraut und blieb mit ihm verbunden. Woher dann trotzdem Nichtverstehn und Auseinandergehn?
Verwey fand „kein öffentliches Wort für die Änderung seines Sinnes nach dem Kriege, keines der Verurteilung für unsere
Feinde, wie er es für uns gefunden hatte“, – dies gibt Wolters als Grund der öffentlichen Trennung an, und da Wolters dies schreibt, so unterliegt es keinem Zweifel, daß zumindest er hier den
entscheidenden Punkt erblickt hat, – ein lehrreiches Zeugnis, auf wie vielen verschiedenen Ebenen gleichzeitig ein geistiges Ereignis seine Deutung finden kann. Aber Wolters ist sachlich im
Irrtum und nichts steht davon in Georges Sprüchen und sehr anders lauteten auch alle seine Worte im Gespräch.
Daß der Holländer das Selbst- und Ehrgefühl des Geheimen Deutschland mit dem landläufigen Patriotismus zusammenwarf, das hat George ihm freilich verargt. Aber nur daß ein Dichter wie
Verwey kein Ohr mehr für die Neue Dichtung hatte; daß ein Freund, dessen menschlich-warme Offenheit ihn noch bei der letzten Begegnung ergriffen, dennoch nicht weiter seinen Weg mit
ihm schreiten konnte und auch nicht wollte, – das hat den Meister tief bewegt. Ähnlich mag es Nietzsche zumut gewesen sein, als Jakob Burckhardt sich vor ihm verschloß... Es war das einzige Mal,
daß der Besucher George von einer gegensätzlichen dichterischen Aufgabe sprechen hörte (6. April 1920.), und in diesem Zusammenhang fiel die Frage: ob wohl allen fremden Völkern
endgültig der Sinn für die Deutsche Dichtung verschlossen sei. Dies war die wirkliche, die geistige Ebene von Georges „Streit“.
Das Wort von der gegensätzlichen Aufgabe will uns noch heute
als eine ungewöhnliche Anerkennung Verweys erscheinen, – der erste der Trennungs-Sprüche kennt nicht zwei, sondern nur eine einzige Dichter-Pflicht, und ihr hat Verwey sich versagt. Aber
wieder ist es die Vielzahl der Sprüche, die schon als solche davon zeugt, dass George durch das andre Handeln und den andren Glauben des holländischen Dichters betroffen, ja beunruhigt war.
Verwey ist es gewesen der als erster schon früh die Frage nach dem Wesen des Dichters aufwarf und der sich seit dem Siebenten
Ring immer stärker zurückzog, je deutlicher das Prophetentum in George zum Durchbruch und Ausdruck gelangte. Verweys Begriff des Dichters und der Dichtung war hier überschritten, – von
unserm Standpunkt aus: durch ein lebendiges Werk widerlegt. Was aber hätte George Verwey erwidern sollen? Wer nicht vor dem gestalteten Werk sich als überwunden bekannte, – wie sollte
den ein Argument überzeugen? Und dennoch hat George sich wohl von Verwey getrennt, doch nicht ihn „verworfen“. In dieser Tatsache, die scharf von andern Trennungen der Früh- und
Spätzeit absticht, liegt wohl die gleiche Anerkennung wie in den angeführten Worten. Die einzige Deutung in Georges Sinn ist doch wohl diese: je klarer für George selbst seine Berufung als Dichter
der Deutschen hervortrat, umso stärker erschloß sich ihm die deutsche Grenze seines Reichs in dieser Ewe.
Auch hier hat sich die Deutung in festen Schranken zu halten. Doch beachte man dies: Georges Deutschtum war, in Ursprung und, Wesen und Richtung immer europäisch oder gar – um ein
frühes Lieblingswort des Freundeskreises zu gebrauchen – immer kosmisch,– kosmisch in jedem Betracht. Ob George von seinen Eltern erzählte, ob er im Gedicht die Ursprünge beschwört, ob er
seine Fahrten von Nord nach Süd, von West nach Ost des Kontinentes schilderte, – stets war es Natur und Geist, Landschaft und Geschichte Europens, die er durchlebt und durchmessen
hatte und deren Weite und Reichtum er mit sich brachte ins heimatliche Gefild. Vielleicht lag in diesem Schimmer der Ferne, lag in der hellenischen Anmut und im römischen Hauch, in der
fränkischen Grazie und der polnischen Grandezza der tiefste Grund, warum der Meister und seine deutschen Freunde nirgendwo sonst so dumm und dreist als Fremdlinge begafft und
begeifert wurden als unter Deutschen, – jedenfalls lag in jener Allumfassung des Georgeschen Wesens, in dem alle Blut- und alle Geistesströme von Ägypten über Hellas und Rom, das antike und
das christliche, bis hin zu den Germanen sich vereinigten, jene Selbstverständlichkeit begründet, mit welcher schon der Jüngling alle Kultursprachen sich zu eigen machte und mit welcher der
Mann alle lebenden Dichter aller Nationen zu kennen und zu binden suchte. Da er – wie unter seinen Freunden der Pole Waclaw Lieder – zum Herrscher geboren war, konnten hierbei
Prüde leicht in ihm als diktatorisches Ausgreifen mißverstehen, was natürliche Äußerung seiner selbstsicheren, durch keine vergänglich-geschichtliche Grenze gebundenen Art gewesen ist.
Und andrerseits mußte ihm daher jedes Verständnis dafür fehlen, daß selbst Menschen geistigen Ranges die politischen Grenzen in irgend einem Sinn auch als geistige Grenzen und sogar geistigen
Maßstab gelten ließen.
In der gleichen Folge der „Blätter“, in der das Lob der Kleinstaaten verkündet wird, ist – wohl an Hofmannsthal gerichtet
– mit Schärfe erklärt: „ein dichter aus dem Östreichischen hat entweder eine bedeutung als deutscher dichter oder keine“ (Blätter für die Kunst. 5. Folge.). Zwischen jenem Lob und dieser
Feststellung war und ist kein Widerspruch: so wenig Gewicht haben Tatsachen des politischen Raums neben den Werten des geistigen Reichs.
Aber aus dem gleichen Grunde verwischen sich für George auch die Unterschiede zu fremdsprachigen Dichtern, – vorab zum Dichter der stammverwandten Niederlande, zu Verwey. „In den
höchsten regionen der kunst” (Blätter für die Kunst. 6. Folge.) verschwinden ihm selbst die Gegensätze „Nord und Süd, Italien und Niederland“. Aber sind sie für Verwey verschwunden?
Von diesen höchsten Regionen aus urteilt George, wenn er Verwey das dem Dichter Geziemende entgegenhält. Als Holländer, dem der Stern Spinoza neben dem Stern Georges leuchtet,
handelt und dichtet und erwidert Verwey. Dadurch allein erscheint Georges geistiges Deutschtum auf den politischen Raum der Deutschen zurückgeworfen, und dadurch allein wurde zeitpolitisch
deutbar, was für beide Dichter ein „Streit“ im geistigen Reich gewesen und geblieben ist, der darum auch mit der äußeren Trennung nicht abbrach ..
Hier ist der Punkt erreicht, an dem gerade der Wissende sich mit Andeutungen begnügen, auf Deutungen verzichten muß. Es gibt
Grenzen der Völkerseele, die auch der größte Einzelne nicht überspringt. Der Dichter Verwey war gewiß beheimatet in „der Ewigen Reiche“. Aber der Holländer mußte zurückschrecken, wenn
er erkannte, daß in dieser Weltstunde der deutsche Dichter die Stimme des Gottes war, – der deutsche Dichter, in dessen Bild und Traum des Reiches ferne Erinnerungen mitschwangen an die
Ottonen und die Staufer-Zeit und ferne Hoffnungen auf Hölderlins verheißenes Germanien, das wehrlos Rat gibt rings den Königen und den Völkern.
Wer nur die Freundschaft Georges und Verweys erfassen will, darf hier sich damit bescheiden, daß er einen unausweichlichen tragischen Ausgang feststellt und beklagt. Wer aber mit den
Dichtern glaubt, daß im Streite, den sie fühlen, sich die Zukunft ihrer Völker vorauskündet, wird mit ihnen über diese Begebnisse nachsinnen und wird erkennen, wie sich jenseits der Trennung
Georges versöhnende Hoffnung erfüllt. Denn Verwey endet den Bruderstreit mit einer Ehrung des Toten, die er dem Lebenden versagte: „Mein König“ (Verwey, Het lachende Raadsel. Santpoort 1935.).
 
|