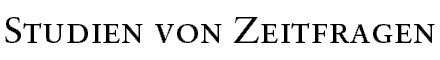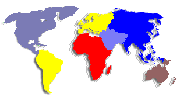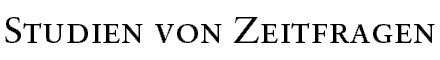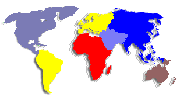|

Das Neuste von China / Teil I
Zur Erhellung der Geschichte unserer Zeit
Gebracht wird darin ein nach Europa übermittelter Bericht über die nun
erstmals staatlich zugelassene Verbreitung des Christentums. Weiter werden viele bisher unbekannte Informationen gegeben: über die Förderung der europäischen Wissenschaften, über die Sitten und
Gebräuche des Volkes und die moralische Einstellung vor allem des Herrschers selbst sowie über den Krieg der Chinesen mit den Russen[1] und ihren Friedensschluß.
Herausgegeben von G(ottfried) W(ilhelm) L(eibniz)
Inhaltsverzeichnis auf der folgenden Seite
2. Auflage, vermehrt durch das Hinzukommen einer weiteren Schrift 1699
Verzeichnis der in diesem Buch enthaltenen Schriften:
Im ersten Teil, der bereits im vorangegangenen Jahr[2] erschien:
1. Bericht über die jetzt endlich - 1692 - erfolgte Erteilung der Erlaubnis,
die christliche Religion in China zu verbreiten; von Pater José Soares aus Portugal[3], Leiter des Pekinger Collegiums
2. Auszüge aus einem in China gedruckten Astronomiebuch von Pater Verbiest[4] über die Studien des jetzt regierenden Herrschers
3. Brief von Pater Grimaldi[5] an Leibniz aus Goa vom 6. Dezember 1693
4. Brief des belgischen Paters Antoine Thomas[6] aus Peking vom 12. November 1695
5. Kurze Beschreibung[7] des Weges nach China, der von der russischen Gesandtschaft in den Jahren 1693, 1694 und 1695 zurückgelegt wurde, in verbesserter Ausgabe
6. Anhang: Auszüge von Briefen des Paters Gerbillon[8] aus der unter russischer Herrschaft stehenden Stadt Nertschinsk an den Grenzen Chinas vom 2. und 3. September 1689, in denen er über
den Krieg und den endlich zustandegekommenen Friedensschluß zwischen Chinesen und Russen berichtet
Im anschließenden Teil, der jetzt veröffentlicht wird:
7. Herrscher-Porträt des jetzt regierenden Kaisers der Chinesen,
gezeichnet von dem französischen Jesuitenpater Joachim Bouvet[9], aus
dem Französischen (ins Lateinische) übersetzt
Dem geneigten Leser zum Gruß[10]
G(ottfried) W(ilhelm) L(eibniz)
1. Durch eine einzigartige Entscheidung des Schicksals, wie ich glaube,
ist es dazu gekommen, daß die höchste Kultur und die höchste technische Zivilisation der Menschheit heute gleichsam gesammelt sind an zwei äußersten Enden unseres Kontinents, in Europa und in Tschina[11] (so nämlich spricht man es aus), das gleichsam wie ein
Europa des Ostens das entgegengesetzte Ende der Erde ziert. Vielleicht verfolgt die Höchste Vorsehung dabei das Ziel - während die zivilisiertesten (und gleichzeitig am weitesten voneinander
entfernten) Völker sich die Arme entgegenstrecken -, alles, was sich dazwischen befindet, allmählich zu einem vernunftgemäßeren Leben zu führen. Und es geschieht nicht durch Zufall, glaube ich,
daß die Russen, die durch ihr riesiges Reich China mit Europa verbinden und den äußersten Norden des unzivilisierten Gebiets entlang den Küsten des Eismeeres beherrschen, unter dem
tatkräftigen Bemühen des jetzt regierenden Herrschers selbst[12]
wie auch durch den ihn mit Ratschlägen unterstützenden Patriarchen[13], wie ich gehört habe, dazu angehalten werden, unseren Errungenschaften nachzueifern.
2. Nun zum chinesischen Reich: China nimmt es schon an Größe mit Europa als Kulturlandschaft auf und übertrifft es sogar in der Zahl seiner Bewohner[14], es weist aber auch noch vieles andere auf, in dem es mit uns wetteifert und bei nahezu "ausgeglichenem Kriegsglück" uns bald übertrifft, bald von uns übertroffen wird. Aber um den
Vergleich auf das Wesentliche zu konzentrieren (denn um alle Aspekte zu behandeln, bedürfte es einer zwar nützlichen, aber gleichwohl langwierigen und hier nicht angebrachten mühevollen
Untersuchung): In den Fertigkeiten, deren das tägliche Leben bedarf, und in der experimentellen Auseinandersetzung mit der Natur sind wir - wenn man eine ausgleichende Gegenüberstellung
vornimmt - einander ebenbürtig, und jede von beiden Seiten besitzt da Fähigkeiten, die sie mit der jeweils anderen nutzbringend austauschen könnte; in der Gründlichkeit
gedanklicher Überlegungen und in den theoretischen Disziplinen sind wir allerdings überlegen. Denn außer in der Logik und Metaphysik sowie in der Erkenntnis unkörperlicher Dinge -
Wissenschaften, die wir mit Fug und Recht als die uns eigenen beanspruchen - zeichnen wir uns sicherlich bei weitem in der gedanklichen Erfassung der Formen[15] aus, die durch den Verstand vom Stofflichen abstrahiert werden, d. h. in der
Mathematik, wie man in der Tat feststellen konnte, als die Astronomie der Chinesen in einen Wettstreit mit der unsrigen trat. Sie scheinen nämlich jene große Erleuchtung des menschlichen
Verstandes, die Kunst der Beweisführung, bisher nicht gekannt und sich mit einer Art aus der Erfahrung gewonnener Mathematik[16] begnügt zu haben, wie sie bei uns weithin Handwerker beherrschen. Auch in Kriegskunst und -wissenschaft befinden sie sich hinter unserem Stand - nicht so sehr aus Unkenntnis als
vielmehr in bewußter eigener Absicht, da sie nämlich alles verachten, was bei den Menschen Aggression erzeugt oder fördert, und weil sie - beinahe in Nacheiferung der höheren Lehre
Christi, die nicht Wenige mißverstehen und bis zur Ängstlichkeit übertreiben - Kriege verabscheuen. Sie würden damit weise handeln, wenn sie allein auf der Erde existierten; unter den
jetzigen Verhältnissen aber läuft es darauf hinaus, daß auch rechtschaffene Menschen die Techniken, anderen Schaden zuzufügen, pflegen müssen, damit die Bösen nicht alle Macht an
sich ziehen. In diesen Bereichen sind wir also die Überlegenen.
3. Aber wer hätte einst geglaubt, daß es auf dem Erdkreis ein Volk gibt, das uns, die wir doch nach unserer Meinung so ganz und gar zu
allen feinen Sitten erzogen sind, gleichwohl in den Regeln eines noch kultivierteren Lebens übertrifft? Und dennoch erleben wir dies jetzt bei
den Chinesen, seitdem jenes Volk uns vertrauter geworden ist. Wenn wir daher in den handwerklichen Fertigkeiten ebenbürtig und in den
theoretischen Wissenschaften überlegen sind, so sind wir aber sicherlich unterlegen - was zu bekennen ich mich beinahe schäme - auf dem
Gebiet der praktischen Philosophie, ich meine: in den Lehren der Ethik und Politik, die auf das Leben und die täglichen Gewohnheiten der
Menschen selbst ausgerichtet sind. Es ist nämlich mit Worten nicht zu beschreiben, wie sinnreich bei den Chinesen - über die Gesetze anderer
Völker hinaus - alles angelegt ist auf den öffentlichen Frieden hin und auf die Ordnung des Zusammenlebens der Menschen, damit sie sich selbst
so wenig Unannehmlichkeiten wie möglich verursachen. Es ist eine sichere Tatsache, daß die größten Übel den Menschen durch sich selbst und voneinander wechselseitig entstehen, und nur allzu wahr ist der
Spruch, daß der Mensch dem Menschen ein Wolf[17] ist. Es handelt sich
dabei um eine große Torheit speziell unsererseits, die aber auch ganz allgemein für die Menschen gilt: Obwohl wir schon so vielen Unbilden der Natur ausgeliefert sind, häufen wir uns selbst noch
Elend dazu auf, als ob es anderswoher fehlte.
4. Wenn irgendeine Nation für dieses Übel - auf welche Weise auch immer - ein Heilmittel geschaffen hat, so sind sicherlich die Chinesen im
Vergleich zu den übrigen zu einer besseren Regelung gekommen und haben in ihrer riesigen Menschengemeinschaft beinahe mehr erreicht als
bei uns die Gründer religiöser Orden in ihrem engen Kreis. So groß ist die Gehorsamkeit gegenüber den Höherstehenden, so groß die Ehrerbietung gegenüber den Älteren und von solcher beinahe religiösen
Art die Sorge und Verehrung der Kinder gegenüber ihren Eltern, daß ihnen gegenüber etwas Kränkendes auch nur durch ein Wort hervorzurufen den Chinesen nahezu unerhört und fast - wie bei uns der
Vatermord - als sühnebedürftiges Verbrechen erscheint. Ferner gibt es zwischen Gleichgestellten oder solchen, die einander relativ wenig verbunden sind, staunenswerten Respekt und einen vorgeschriebenen
Kodex von Höflichkeitspflichten[18], der uns - die wir freilich zu wenig
gewohnt sind, nach einem Grundsatz und Regeln zu handeln - etwas Unterwürfiges an sich zu haben scheint, der ihnen aber durch ständige Anwendung zur Natur geworden ist und gerne
befolgt wird. Die chinesischen Bauern und Bediensteten (das ist von unseren Landsleuten mit Staunen beobachtet worden) betragen sich, wenn sie ihren Freunden Lebewohl sagen müssen
oder sich nach einer langen Abwesenheit wieder des gegenseitigen Anblicks erfreuen, gegeneinander so liebenswürdig und so respektvoll, daß sie es mit den gesamten Umgangsformen
europäischer Hochadliger aufnehmen könnten. Was soll man da erst von den Mandarinen[19], was von den höchsten Staatsbeamten[20] erwarten? So haben sie es erreicht, daß kaum
jemand dem anderen im gemeinsamen Gespräch auch nur mit einem Wörtchen zu nahe tritt und ihnen selten Anzeichen von Haß, Zorn oder Erregung entgleiten. Bei uns dauert ein gewisser
Respekt und vorsichtig abgewogener Gesprächston kaum - und nicht einmal das - in den ersten Tagen einer neuen Bekanntschaft an, sondern wird bald mit zunehmender Vertrautheit die
vorsichtige Zurückhaltung abgelegt - was zwar ganz wie angenehme Freiheitlichkeit aussieht, woher aber bald Verachtung, bissige Worte, Zorneserregungen und schließlich Feindschaften
herrühren; dagegen werden bei den Chinesen sogar Nachbarn, ja selbst Hausangehörige durch einen Rahmen von Gepflogenheiten so im Zaum gehalten, daß eine Art von gegenseitiger Förmlichkeit gewahrt bleibt.
5. Und mögen sie auch weder von Geiz noch Zügellosigkeit, noch
Ehrsucht frei sein (daher ist insoweit auch von ihnen wahr, was über die Mondvölker in dem Stück "Harlekin, Kaiser des Mondes" im Theater[21] oft wiederholt wurde, es geschehe dort alles genauso wie hier -
c'est tout comme ici), und mögen die Chinesen die wahre tugendhafte Lebensführung noch nicht ganz erreicht haben - die dürfte man wohl nur von der himmlischen Gnade und der
christlichen Lehre erwarten -, so haben sie dennoch die bitteren Resultate menschlicher Fehler gemildert, und obwohl sie die Wurzeln sündhafter Vergehen aus der menschlichen Natur nicht
ausrotten konnten, haben sie gleichwohl gezeigt, daß die hervorsprossenden Schößlinge böser Eigenschaften zu einem guten Teil niedergehalten werden können.
6. Wer aber dürfte nicht auch über folgendes erstaunen: Der Herrscher
eines so großen Reiches[22], der in seiner Bedeutung den einem
Menschen möglichen Gipfelpunkt beinahe überschritten hat und gleichsam als ein sterblicher Gott angesehen wird, so daß auf einen Wink von ihm alles geschieht, pflegt dennoch solchermaßen
zu Tugend und Weisheit erzogen zu werden, daß er es gerade seiner höchsten Stellung unter den Menschen für würdig zu erachten scheint, seine Untertanen in einer unglaublichen Achtung
vor den Gesetzen und in Ehrfurcht gegenüber weisen Männern noch zu übertreffen. Nicht leicht dürfte einem etwas der Hervorhebung Würdigeres vorkommen, als zu sehen, wie der
bedeutendste der Herrscher, der in der Gegenwart alles vermag, die Nachwelt so ehrfürchtig achtet und mehr durch die Furcht vor den Annalen[23] der Geschichte in seinem Handeln beschränkt wird
als andere durch Ständeversammlungen und Parlamente und sich auch mit großer Umsicht in acht nimmt, daß nicht diejenigen, denen es übertragen ist, den geschichtlichen Stoff seiner
Herrschaft aufzubereiten, irgendetwas in jene verschlossenen und unverletzlichen kleinen Kästen hineinbringen können, wodurch seine Beurteilung in der Nachwelt befleckt werden könnte.
7. Das gilt so sehr, daß der jetzt regierende K'ang-hsi, ein nahezu
beispiellos hervorragender Fürst, wie immer er auch den Europäern geneigt ist, es dennoch gegen die Empfehlung seiner obersten Behörden[24] nicht gewagt hat, die Freiheit der christlichen Religion durch ein staatliches Gesetz zu sanktionieren, bis ihre Heiligkeit geklärt war und es feststand, daß auf keine andere Weise der
große und heilsame Plan des Kaisers besser zur Vollendung gebracht werden könne, in China europäische Fertigkeiten und Wissenschaften einzuführen. In dieser Angelegenheit scheint mir
der Kaiser als Einzelperson weiter vorausgeschaut zu haben als alle seine obersten Behörden; und der Grund für eine so überragende Klugheit war, wie ich glaube, die Tatsache, daß er
Europäisches mit Chinesischem verband. Denn in jeder Wissenschaft der Chinesen war er - beinahe über die einem Privatmann mögliche Gründlichkeit hinaus - von Kindheit an schon
damals so unterwiesen, daß er in den Prüfungen[25] der
Mandarine, durch welche Ehrengrade und staatliche Stellen übertragen werden, als außerordentlich strenger Richter gilt und (was bei den Chinesen Zeichen höchster Gelehrsamkeit ist) seine
Überzeugungen in bewundernswerter Weise in Schriftzeichen[26]
ausdrücken kann, und zwar bis zu einem solchen Grade, daß er ein von den gelehrtesten Männern der Christen abgefaßtes Bittschreiben[27] selbst noch verbessern konnte. Daher war er zunächst schon in der Gelehrsamkeit seines Volkes genau
bewandert und bereits nicht mehr ein ungerechter Schiedsrichter; sobald er aber dann von dem belgischen Pater Ferdinand Verbiest aus Brügge, aus dem Jesuitenorden, einem Schüler des Kölners
Johann Adam Schall[28], einen Vorgeschmack von europäischen
Wissenschaften erhalten hatte, wie ihn bis dahin vielleicht noch niemand in jenem Reich gehabt hat, konnte er gar nicht anders, als sich über alle Chinesen und Tataren[29] durch seine Kenntnis und Voraussicht zu erheben, wie wenn man auf eine ägyptische
Pyramide noch einen europäischen Turm setzen würde.
8. Ich erinnere mich, daß Pater Claudio Filippo Grimaldi, ein ausgezeichneter Vertreter desselben Ordens, mir gegenüber in Rom
nicht ohne Bewunderung die Tugend und Weisheit dieses Fürsten pries, denn um nichts über seine Gerechtigkeitsliebe, die liebende Fürsorge für seine Völker, seine gemäßigte Lebensweise und die übrigen
Lobpreisungen zu sagen - Grimaldi hob hervor, daß des Kaisers erstaunlicher Wissensdurst nahezu unglaublich sei. Denn er, den seine fürstlichen Verwandten und die bedeutendsten Männer des gesamten
Reiches von ferne verehren und in seiner Nähe anbeten, bemühte sich zusammen mit Verbiest in der Abgeschlossenheit eines inneren Gemachs drei oder vier Stunden lang täglich an mathematischen Geräten und
Büchern, wie ein Schüler mit seinem Lehrer; und er machte so große Fortschritte, daß er die euklidischen Beweise erfaßte, die trigonometrischen Berechnungen verstand und so in der Lage ist, die
astronomischen Erscheinungen in Zahlen auszudrücken. Ja, er verfaßte sogar - dies hat uns Pater Louis Le Comte[30], der neulich von dort
zurückgekehrt ist, in einem veröffentlichten Bericht über China mitgeteilt - selbst ein Buch über die Mathematik, um mit den Grundkenntnissen einer so bedeutenden Wissenschaft und der
Kenntnis wichtiger Wahrheiten in eigener Person seine Kinder vertraut und die Weisheit, die er seinem Reich erschloß, im eigenen Haus erblich zu machen, womit er für das Glück seiner
Völker noch über sein Leben hinaus vorsorgte; ich sehe keine hervorragenderen Pläne, die in menschlichen Bereichen betrieben werden könnten, als diese.
9. Man muß allerdings die Mathematik nicht nach Art eines Handwerkers, sondern der eines Philosophen betreiben. Tugend fließt
nämlich aus Weisheit, die Seele der Weisheit aber ist die Wahrheit, und diejenigen, die die Beweise der Mathematik erforscht haben, haben das
Wesen ewiger Wahrheiten erfaßt und können Sicheres von Unsicherem unterscheiden, während die übrigen Menschen zwischen Vermutungen hin- und herschwanken und ähnlich, wie Pilatus[31] fragte, nicht wissen, was Wahrheit ist. Daher besteht kein Zweifel, daß der Herrscher
der Chinesen deutlich das gesehen hat, was in unserem Teil der Welt einst Platon[32] hervorhob, nämlich, daß man nur durch die
Mathematik mit den Geheimnissen der Wissenschaft vertraut werden könne. Und daß die Chinesen, auch wenn sie seit einigen tausend Jahren mit erstaunlichem Eifer die Gelehrsamkeit pflegen
und ihren Gelehrten die höchsten Preise aussetzen, dennoch nicht zu einer exakten Wissenschaft gelangt sind, ist, wie ich glaube, durch nichts anderes bewirkt worden als dadurch, daß sie jenes
"eine Auge"[33] der Europäer, d.h. die Mathematik, nicht hatten,
Obgleich aber jene uns für einäugig gehalten haben, so haben wir dennoch noch ein weiteres Auge, das ihnen noch nicht genügend bekannt ist, nämlich die "Erste Philosophie"[34], durch die wir zu der Erkenntnis auch unstofflicher Dinge gelangen konnten. Verbiest hatte sich bereits angeschickt, diese zu lehren, weil er zu
Recht der Meinung war, daß so der christlichen Religion besser der Weg bereitet werde, aber er wurde durch seinen Tod daran gehindert.
10. Ich habe jetzt erfahren, daß die französischen Jesuitenpatres
Gerbillon und Bouvet unter königlicher Schirmherrschaft und tätiger Anteilnahme von de la Chaize[35] und Verjus[36], bedeutender Männer dieses Ordens und Volkes, zusammen mit vier weiteren in ihrer
Eigenschaft als Mathematiker aus der Akademie der Wissenschaften in den Osten geschickt worden sind und außer durch die Mathematik auch durch die Lehre unserer Philosophie
sich den Herrscher verpflichtet haben. Wenn das so weitergeht, fürchte ich, daß wir bald auf jedem anerkennenswerten Gebiet den Chinesen unterlegen sein werden. Dies sage ich nicht
deshalb, weil ich ihnen die neue Erleuchtung neidete, da ich sie vielmehr dazu beglückwünsche, sondern weil es zu wünschen wäre, daß wir auch unsererseits von ihnen Dinge lernten, die
mehr noch in unserem Interesse liegen würden, nämlich vor allem die Anwendung einer praktischen Philosophie und eine vernunftgemäßere Lebensweise, um von ihren anderen
Errungenschaften jetzt nichts zu sagen. Jedenfalls scheint mir die Lage unserer hiesigen Verhältnisse angesichts des ins Unermeßliche wachsenden moralischen Verfalls so zu sein, daß es
beinahe notwendig erscheint, daß man Missionare der Chinesen zu uns schickt, die uns Anwendung und Praxis einer natürlichen Theologie[37] lehren könnten, in gleicher Weise, wie wir ihnen
Leute senden, die sie die geoffenbarte Theologie lehren sollen. Ich glaube daher: Wäre ein weiser Mann zum Schiedsrichter nicht über die Schönheit von Göttinnen[38], sondern über die Vortrefflichkeit von Völkern gewählt worden, würde er den goldenen Apfel den Chinesen geben, wenn wir sie nicht gerade in
einer Hinsicht, die aber freilich außerhalb menschlicher Möglichkeiten liegt, überträfen, nämlich durch das göttliche Geschenk der christlichen Religion.
11. Diese so große Gabe des Himmels dem chinesischen Reich zu bringen, darum bemühen sich Europäer mit lobenswertester Aufopferung
seit einer Reihe von Jahren, besonders aber der Jesuitenorden, dessen Einsatz in dieser Sache auch diejenigen anerkennen müssen, die ihn als
sich feindlich gesonnen betrachten. Ich weiß, daß Antoine Arnauld[39], ein Mann, der unter die Leuchten unseres Zeitalters zu rechnen ist und der mit mir einst befreundet war, leidenschaftlich die Jesuiten bekämpfte und dabei ihren Missionaren einiges
vorgeworfen hat. Aber das geschah, wie ich glaube, in einigen Fällen heftiger, als es berechtigt war, denn nach dem Beispiel des Apostels Paulus muß man "allen alles werden"[40], und die Ehrenbezeugungen für Konfuzius scheinen nichts von religiöser Anbetung an sich zu haben. In gleicher Weise ist Arnauld in
seiner"Apologie" auch mit den Niederländern und Engländern allzu ungerecht verfahren, indem er entweder die Trägheit einiger weniger allen zuschrieb oder den sarkastischen Äußerungen
Taverniers Glauben schenkte, der durch eine private Kränkung gegen die Niederländer aufgebracht war. Dabei ist doch bekannt, daß viele tausend Menschen in beiden Indien von den
Niederländern und Engländern zum Glauben bekehrt worden sind[41] und man oft in privaten Kreisen wie auch von Staats wegen
Überlegungen anstellte, um dahin zu kommen, Lob und Anstrengung gemeinschaftlich zu teilen - vorausgesetzt, daß der Streit einstweilen beigelegt war. In dieser Angelegenheit gebe
ich, da ich auf die Frömmigkeit und Weisheit der großen Fürsten schaue, die Hoffnung nicht auf, sofern nur erst Europa der Friede zurückgegeben ist[42].
12. Gleichwohl verschafft die Einrichtung der religiösen Orden den heiligen Missionen günstige Bedingungen von der Art, wie sie die
Versuche anderer nicht leicht erreichen. Möge die Unternehmung aber so betrieben werden, daß die Völker, deren Heil wir im Auge haben, ja nicht
erkennen, in welchen Dingen wir Christen unter uns uneins sind. Wir stimmen ja doch alle insgesamt in jenen Grundsätzen des christlichen Glaubens überein, bei deren Annahme durch jene Völker niemand an
ihrer Rettung verzweifeln würde, solange man eben nur nichts, was ketzerisch, unecht und überhaupt mit schwerem Zweifel behaftet ist, daranhängte. In dieser Angelegenheit muß nach dem Vorbild der alten
Kirche in der Weise klug gehandelt werden, daß man weder unüberlegt alle Glaubensgeheimnisse an Gemüter heranträgt, die darauf nicht vorbereitet sind, daß aber dennoch auch nicht dadurch, daß man sich
bemüht, den Völkern entgegenzukommen, die christliche Wahrheit Schaden nimmt - wie das nach der Klage von Louis de Dieu[43] in einem Evangelium geschehen ist, das auf Persisch abgefaßt wurde. Ich
sehe freilich, daß Rom selbst bisweilen Fortschritte verzögert zu haben scheint, aus einer Ängstlichkeit heraus, die aus zweifelhaften Berichten entstand, und daß einige übel Beratene
und in den menschlichen Gewohnheiten Unerfahrene - allerdings unter dem Protest von Einsichtigeren - die weit entfernt lebenden Christen an alle Vorschriften der abendländischen Gläubigen
heranzwingen wollten; das war ein Fehler, der sie in der Tat den Untergang der bereits blühenden Kirchengemeinschaft bei den Abessiniern kostete[44].
13. Dennoch ist zu hoffen, daß man in Zukunft aus dem Gebot christlicher Klugheit heraus vorsichtiger handeln und sich Mühe geben
wird, jene große und von Gott gegebene Gelegenheit in rechter Weise zu nutzen, seitdem der Herrscher von China den christlichen Glauben durch
staatliches Gesetz zugelassen hat; die Geschichte dieser Entwicklung übermittelt die nachstehende Schrift. Denn bis zu diesem Zeitpunkt war
die christliche Glaubensausübung mehr geduldet als erlaubt, und das Wohlwollen der chinesischen oder tatarischen Herrscher sowie die Verdienste unserer Landsleute hatten nur bewirkt, daß man ein Auge
zudrückte - und die Durchführung der Gesetze auf sich beruhen ließ, die gegen nicht anerkannte Sekten strikt gehandhabt werden, zu denen auch
unsere Religion gezählt wurde. Aber die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Sternhimmel und (wie es Verbiest feinsinnig in seinem chinesisch und lateinisch veröffentlichten Werk ausdrückte) die Muse
Urania, die den Herrscher zu beeinflussen geruht hat, bewirkten, daß unsere heilige und wahrhaft "himmlische" Lehre zugelassen wurde[45]. Sobald der Kaiser die sichere Aussagekraft unserer Mathematik
gekostet hatte, erlangte sie bei ihm solche Bewunderung, daß er leicht glaubte, diejenigen, die so zu denken gelernt hätten, lehrten auch in anderen Bereichen das Richtige.
14. Als erster hatte Ricci[46] zu Beginn dieses Jahrhunderts den
Chinesen demonstriert, was die Europäer können. Schall hatte unter dem chinesischen Herrscher und seinem tatarischen Nachfolger in aller Öffentlichkeit einen Triumph über die
chinesische Astronomie davongetragen. Verbiest richtete die christliche Sache, die unter dem noch unmündigen Kaiser durch das Wüten ihrer Gegner schon zu Boden geworfen war[47], mit großem Können wieder auf, und nachdem er bald vertrauten
Umgang mit dem jungen Kaiser erlangt hatte, erlebte er dann auch den beständigen Sinn des ausgewachsenen Mannes. Als er den bereiten Willen des Kaisers, der durch den süßen Geschmack
der Wissenschaften eingenommen war, nun in Anspruch nehmen wollte und Missionare herbeirief, hielten ihn für einige Zeit Streitigkeiten auf, die zwischen den Vertretern des Papstes und
den Portugiesen entstanden, welche das Recht beanspruchten, Bischöfe für China zu ernennen[48]. Aber auch zwischen den
Bischöfen von Baalbek und Beirut, die vom Papst mit weitreichender Vollmacht in den Orient entsandt worden waren, und den Missionaren, die von den religiösen Orden ausgingen und
sich auf ihre Privilegien und das Argument der ersten Inbesitznahme stützten, gab es in wechselvoller Weise Streit, bis die Autorität des Papstes siegte. Nachdem die Verhältnisse also
geordnet worden waren, ließ Verbiest es nicht an eigener Tatkraft fehlen, und da er über sehr großen Einfluß auf den Kaiser verfügte, überzeugte er ihn, daß - wie es ja in der Tat ist - in der
Wissenschaft der Europäer Schätze von weitreichenden Möglichkeiten steckten, und er erreichte es - niemand kann sich daran erinnern, daß dies je von den Chinesen unternommen
worden ist (außer, als ein in den Westen geschickter Gesandter einst von der ersten Insel Indiens das unglückselige Götzenbild Fo mitbrachte)[49] -, daß gerade jener von mir genannte Grimaldi nach Europa entsandt wurde, um Fachleute verschiedener
Professionen heranzuführen. Das Gedenken an die von Verbiest unternommene mühevolle Arbeit stand beim Kaiser in solch hohem Ansehen (nachdem Verbiest schon gestorben und Grimaldi noch
nicht zurückgekehrt war), daß sie in einem für die Religionsfreiheit eingereichten Bittgesuch unter die großen Verdienste der europäischen Gelehrten gerechnet wurde.
15. Bald darauf, nachdem fünf französische in den mathematischen Wissenschaften ausgebildete Jesuiten aus dem Königreich Siam nach China gelangt waren - auch jetzt noch
gegen den Willen der Portugiesen -, ergab sich für unsere Landsleute eine neue Gelegenheit, sich Verdienste beim Kaiser zu erwerben[50]. Die Russen hatten, indem sie in kluger Mäßigung
die unzivilisierten Völkerschaften nach und nach unter ihre Botmäßigkeit brachten, ihr Reich ins Unermeßliche ausgedehnt und sich in der Weise den chinesischen Tataren genähert, daß
schließlich Konflikte um die Grenzen ausbrachen. Der Streit wurde bald mit Waffen, bald mit Verhandlungen ausgetragen. Schließlich kamen in der unter russischer Herrschaft stehenden Stadt
Nertschinsk Gesandte beider Völker, begleitet von nahezu regelrechten Kriegsheeren, zusammen. Die Chinesen brachten in ihrer Delegation die Jesuitenpatres Pereira aus Portugal und
Gerbillon aus Frankreich mit; indem diese als Dolmetscher fungierten, erreichte man es, daß glücklich letzte Hand an die Aufgabe gelegt werden konnte: Es wurde ein sicherer Friede
abgeschlossen, und die Gesandten selbst erklärten öffentlich, daß sie alle - da ihre Wesenszüge und Standpunkte so verschieden waren und sich äußerst mißtrauische Völker hier gegenübertraten
- sich unverrichteter Dinge wieder getrennt hätten, wenn die Jesuiten nicht zur Stelle gewesen wären. Diesen Erfolg hat dann der Kaiser selbst aufs klügste dahingehend genutzt, die
europäischen Gelehrten seinen obersten Behörden zu empfehlen.
[1] „Russen” im lateinischen Text: bei Leibniz immer „Mosci”. Da
jedoch in anderem zeitgenössischem Schrifttum bereits die moderne Bezeichnung „Russen”, lateinisch „Rutheni” – s. z. B. den lateinischen Text des Vertrages von Nertschinsk unten S. 108 ff. –
vorzudringen beginnt, wurde diese durchgehend für die Übersetzung verwendet.
[2] „Im vorangegangenen Jahr”. Die 1. Auflage der Novissima
Sinica erschien tatsächlich 1697, die 2. Auflage 1699, die 1. Auflage also zwei Jahre früher. Doch wurde hier das lateinische „praecedens” wörtlich übersetzt.
[3] Soares, Jose (Joseph) = Sou Lin P’ei-tsang 1656 (Coimbra) -
1736 (Peking), Portugiese, Jesuit, war ab 1680 in Macao, 1684 in Shanghei, 1685 in Yangshow und ab 1688 in Peking, wo er 1692 – 1697 das Jesuiten-Kollegium leitete. Sein von Leibniz (als Anlage 1
der Novissima Sinica) in vollem Wortlaut veröffentlichter Bericht über die Geschichte des Toleranz-Ediktes vom 22. 3. 1692 vermittelt einen wertvollen Einblick nicht nur in die Schwierigkeiten
und Intrigen, mit denen die Jesuiten in China zu kämpfen hatten, wir erhalten auch Informationen, wie die Willensbildung einzelner Behörden und Beamten in Peking und der Zutritt zum Kaiser
K’ang-hsi damals vonstatten gingen, kurz einen Einblick in die damalige chinesische Bürokratie. Aus Raumgründen haben wir darauf verzichten müssen, den bereits von uns aus dem
Lateinischen übersetzten Bericht hier zum Abdruck zu bringen. Der Bericht von Soares wurde u. a. auch von Couplet in seiner Tabula chronologica Sinica Vienne 1703 veröffentlicht.
[4] Verbiest, Ferdinand = Nan Houai-Jen Touen-Pei 1623 (Pitthem
bei Brugge) – 1688 (Peking) Flame, Jesuit, war 1658 in Macao, 1659 in Xi’an und ab 1660 in Peking, wo er sofort zum Hof-Astronomen ernannt wurde, um Adam Schall behilflich zu sein.
Er wurde wie dieser 1664/65 ins Gefängnis geworfen und 1669 wieder in Freiheit gesetzt. Er rekonstruierte das astronomische Observatorium, ließ neue Instrumente bauen und reformierte den
chinesischen Kalender. 1669 wurde er Vorsitzender der Obersten Mathematischen Behörde, 1675 stellvertretender Leiter des Ministeriums für Öffentliche Arbeiten. Er wurde Mandarin 2.
Grades. Zu seinen Obliegenheiten gehörte auch der Guß von Kanonen für K’ang-hsi. 1676 diente er dem russischen Gesandten Spathari als Dolmetscher. Er hat zahlreiche Werke in lateinisch
und chinesisch veröffentlicht. Berühmt ist die von ihm gefertigte und dem Kaiser überreichte Weltkarte. Von Verbiest existieren zahlreiche Bilder, darunter z. B. im te Scheut-Museum in Brüssel.
Leibniz gibt (als Anlage 2) Auszüge aus seinem Astronomie-Buch, „Astronomia Europaea sub Imperatore Tartaro Sinico Cam Hy appellato ex umbra in lucem revocata a R.P. Ferdinando Verbiest
Flandro-Belga a societate Jesu Academiae Astronomicae in Regia Pekinensi Praefecto cum privilegio Caesareo et facultate superiorum”, Dillingen 1687, zu deutsch „Europäische Astronomie
unter dem tatarisch-chinesischen Kaiser mit Namen Cam Hy (K’ang-hsi) aus dem Schatten wieder ans Licht gebracht von P. Ferdinand Verbiest aus Flandern-Belgien aus der Gesellschaft
Jesu`, Leiter der Astronomischen Akademie in Peking”. Mit seiner Veröffentlichung wollte Leibniz vor allem das Interesse und die Lernfreudigkeit des Kaisers K’ang-hsi für die westliche
Wissenschaft dokumentieren.
Wir haben diesen Auszug ebenfalls aus dem Lateinischen ins Deutsche übersetzt, jedoch auch hier auf den Abdruck verzichtet, da er uns zu
umfangreich erschien und er nach dem damaligen Stande der Astronomie hätte kommentiert werden müssen. Wir beschränken uns auf die Wiedergabe von Faksimiles der Titelblätter der chinesischen und in
Deutschland erschienenen Ausgaben und auf die bildliche Wiedergabe des astronomischen Instrumentariums, das im Holzschnitt den beiden Ausgaben vorangestellt war. Vgl. unten S. 38 Verbiest gehört sicher
neben Matteo Ricci und Adam Schall von Bell zu den drei Großen der westlichen Missionare und Persönlichkeiten im China des 16. und 17.
Jahrhunderts. Ein ausführliches Verzeichnis seiner Werke, insbesondere auch der chinesischen, bei Pfister a.a.O., S. 352 – 360, ausführliches
Verzeichnis der Lebensbeschreibungen und Abhandlungen über Verbiest bei Dehergne, a.a.O., S. 289 f. Als neueste Publikationen nennen wir R.
A. Blondeau, Mandarijn en astronoom, Verbiest aan het hof van de Chines. Keizer, Brugge-Utrecht 1970; Helmut Walravens, Die Deutschland-Kenntnisse der Chinesen (bis 1870), nebst einem Exkurs
über die Darstellung fremder Tiere im K’un-yü t’u-schuo des P. Verbiest, Kölner Dissertation 1972; Fang Hao, Vertaling van en comentar op de
levensschets van Ferdinand Verbiest, Dissertation Löwen 1978, alle drei mit ausführlichen Literaturangaben. Als bemerkenswert sei noch erwähnt, daß Verbiest das Modell eines dampfgetriebenen Fahrzeugs in
China entworfen hat und damit als der Erfinder des ersten Automobils gilt, ein Zeichen seiner nicht nur theologischen, philosophischen,
astronomischen und sprachlichen – er hat u. a. auch eine zweibändige tatarische (mandschurische) Sprachlehre geschrieben –, sondern auch seiner technisch-praktischen Fähigkeiten.
[5] Grimaldi, Claudio Filippo = Min Ming-Ngo Tö-Sien 1638
(Cineo/Piemont) – 1712 (Peking) Italiener, Jesuit, wurde auf Betreiben von Verbiest vom Kaiser K’ang-hsi 1671 von Kanton nach Peking gerufen und begleitete den Kaiser, zu dem er in ein
persönliches Vertrauensverhältnis trat, 1683 und 1685 auf Reisen in die Mandschurei. 1711 veröffentlichte er in Peking einen Himmelsatlas Fang sind t’ou kiai. 1688 wurde er Vorsitzender der
Obersten Mathematischen Behörde und Mandarin. Seit 1700 war er Leiter des Jesuiten-Kollegiums in Peking. 1686-1691 war Grimaldi in Europa (Rom, Paris, Wien, München) und reiste über
Smyrna und Persien nach Peking zurück, wo er 1694 wieder eintraf.
Leibniz kam 1689 mit ihm in Rom zusammen und führte mit ihm eingehende Gespräche über China, die sein Interesse für China
wesentlich vertieften und letzten Endes auch den Grund zur Novissima Sinica und den Gedanken des Kultur-Austausches mit China legten. Mit
Grimaldi stand Leibniz bis zum 30. 12. 1696 in regem Briefwechsel. Leibniz veröffentlichte (als Anlage 3 der Novissima Sinica) einen kurzen
Antwortbrief Grimaldis an ihn aus Goa vom 6. 12. 1693, in dem Grimaldi versprach, sich um die Beantwortung der vielen von Leibniz gestellten Fragen zu kümmern.
[6] Thomas, Antoine = Ngan To Ping-ehe (Ngan To = Antonio) 1644 (Namur) – 1709 (Peking) Wallone, Jesuit, wollte zunächst in Japan
missionieren, ging 1682 – 1685 von Macao nach Kanton, war 1686 in Nanking und bereits seit Ende 1686 in Peking. Dort wurde er auf Vorschlag
Verbiests stellvertretender Vorsitzender der Obersten Mathematischen Behörde und Vertreter des sich auf Reisen nach Europa begebenden
Grimaldi. Er wurde Mandarin und begleitete Kaiser K’ang-hsi 1686 auf dessen Reisen in die Mandschurei und mongolischen Gebiete. Thomas hat zahlreiche
Werke und Briefe hinterlassen und zusammen mit Pereira z. B. auf chinesisch eine Lebensbeschreibung Verbiests verfaßt. Zeitweise war er auch als Sekretär für Verbiest tätig.
In seinem von uns nicht veröffentlichten Brief vom 12. 11. 1695 (Anlage 4 der Novissima Sinica) berichtet er über die Förderung des
Christentums durch Kaiser K’ang-hsi, die Bekehrung höchster Würdenträger und Familienangehörigen des Kaisers und weitere Erfolge der Mission in China. Zahlreiche Briefe von Thomas befinden sich noch in
europäischen Archiven. Thomas verfertigte auch eine Landkarte zu dem Vertrag von Nertschinsk vom 7. 9. 1689, die Sebes (s. die Bibliographie S. 105) veröffentlichte. Wir bringen sie auf S. 116/117.
[7] Adam Brand gehörte mit mehreren anderen Deutschen der
russischen Gesandtschaft von Isbrand Ydes an, der 1692 – 1694 von Moskau nach Peking reiste. Brand veröffentlichte seinen Reisebericht 1699 in Amsterdam und fügte diesem Bericht eine
von ihm verbesserte Karte des Amsterdamer Bürgermeisters Witsen bei. Wir veröffentlichen diese Karte auf S. 112/113. Das von Leibniz nach vielen Mühen von Witsen besorgte
Original-Exemplar der Sibirien-Karte scheint in der Niedersächsischen Landesbibliothek, wo es sich in dem Nachlaß von Leibniz befand, abhanden gekommen zu sein.
Leibniz erhielt bereits vor dem Erscheinen des ausführlichen Reiseberichts einen kürzeren Bericht in Briefform von Brand, den er
auszugsweise als Anlage 5 der Novissima Sinica veröffentlichte, war aber mit diesem legendenhaft ausgeschmückten und nicht gerade zuverlässig
anmutenden Vorbericht nicht zufrieden. Wir haben daher diesen Auszug nicht abgedruckt.
[8] Gerbillon, Jean-François = Tschang Tsch’eng Che-tai 1654
(Verdun) – 1717 (Peking) Franzose, Jesuit. Er gab dem Kaiser K’ang-hsi wissenschaftlichen Unterricht und begleitete ihn auf acht Reisen 1689-1698 in die Tatarei. Er war Astronom und Geograph
und fertigte 1692 eine neue Karte der Großen Tatarei an. Er schrieb u. a. eine tatarische Sprachlehre und fertigte den berühmten Bericht über das Zustandekommen des Vertrages von
Nertschinsk, den Du Halde 1735 veröffentlichte. Siehe die Bibliographie beim Vertrag von Nertschinsk unten S. 105. Die Leitung der Jesuiten-Unterhändler in Nertschinsk hatte der
Portugiese Pereira, dessen Tagebuch erst 1961 von Sebes herausgegeben wurde (mit einer Übersetzung aus dem Portugiesischen ins Englische), das wir weitgehend bei unserer
Behandlung des Vertrages von Nertschinsk herangezogen haben. Zahlreiche Briefe von Gerbillon sind noch nicht veröffentlicht.
Den von Leibniz gefertigten Auszug der Briefe von Gerbillon über den Vertrag von Nertschinsk (Anlage 6 der Novissima Sinica) bringen wir aus
dem Lateinischen in deutscher Übersetzung unten S. 106. Ihm stellen wir die heutigen zugänglichen Informationen – erstmalige Übersetzung des lateinischen Vertragstextes ins Deutsche – gegenüber, um die
Unzulänglichkeit der Leibniz damals zugänglichen Informationen zu zeigen, die seine auch heute noch wichtig erscheinenden Schlußfolgerungen nur um so bemerkenswerter erscheinen lassen.
Nachzutragen bleibt noch, daß Gerbillon mit Spenden des kaiserlichen Hofes in Peking eine neue Kirche bauen und eröffnen konnte, zu der
Kaiser K’ang-hsi nicht nur Geld gab, sondern auch Kalligraphien von seiner Hand als Schmuck beisteuerte.
[9] Bouvet, Joachim = Pei Tsin Ming-Yuan 1656 (Mans) – 1730
(Peking), Franzose, Jesuit. Er gehörte zu den sechs Mathematikern, die Ludwig XIV. mit Gastgeschenken nach China entsandte. Nach seiner Ankunft in Peking (1688) wurde er 1693
vom Kaiser K’ang-hsi als Gesandter mit Gegengeschenken nach Frankreich geschickt, kehrte 1699 zurück. Er wurde 1700 erneut zur Beilegung des Ritenstreites nach Europa, und zwar nach Rom,
entsandt, jedoch bereits in Kanton zurückgerufen. In Peking arbeitete er eng mit Gerbillon zusammen und wurde wie dieser und andere Vertrauter des Kaisers, den er in Mathematik
unterrichtete. Er richtete außerdem das erste Chemie-Laboratorium in China ein.
Außer zahlreichen Briefen (darunter noch viele nicht herausgegeben) nennt Pfister 14 Werke Bouvets, darunter Reisebeschreibungen,
Abhandlungen über den Himmelskult der Chinesen, des Buches der Wandlungen (I-Ging), ein chinesisch-französisches Wörterbuch und vor allem das als Anhang 6 der 2. Auflage der Novissima Sinica 1699 von
Leibniz beigefügte „Historische Porträt des Kaisers von China”, das er König Ludwig XIV. von Frankreich widmete und mit einem Bild von
K’ang-hsi versah, mit dem Leibniz die 2. Auflage der Novissima Sinica schmücken ließ, das wir ebenso wie Lach dieser 2. Auflage entnommen und auf den Umschlag unserer Veröffentlichung gesetzt haben. In
diesem Buch zieht Bouvet Parallelen zwischen Ludwig XIV. und Kaiser K’ang-hsi, wobei seine Wertschätzung für K’ang-hsi – wahrscheinlich bewußt mit politischer Tendenz – besonders zum Ausdruck kommt. Das
Buch wäre es wert, auch heute noch in deutscher Sprache veröffentlicht zu werden, wir haben aber derzeit aus Raumgründen davon absehen müssen.
[10] „Dem geneigten Leser zum Gruß”: die lateinische
Begrüßungsformel ist stärker, denn hier ist „salutem” noch durch den Superlativ „plurimam” hervorgehoben, in der Übersetzung jedoch von uns weggelassen, weil es in unserer Sprache keine
rechte Entsprechung gibt.
[11]Tschina: Der kurze Vermerk, der sich hier bei Leibniz über
Schreibweise und Aussprache der richtigen Bezeichnung für China findet (vgl. auch Kap. 21), spiegelt noch ein wenig von den Schwierigkeiten wider, die die Europäer damit hatten, einen
zutreffenden Namen für das Reich der Mitte zu finden. Die Reihe der abendländischen Namengebungen für China ist nahezu eine Geschichte für sich:
Die für das Mittelalter dann maßgebliche Namensform hat der Franziskanermönch Giovanni de Piano Carpini geprägt, der 1245 von
Papst Innozenz IV. in offiziellem Auftrag an den Hof des Mongolenherrschers in Karakorum geschickt wurde. In seinem über diese Reise verfaßten Bericht bezeichnet Piano Carpini China als „Kitai”
(die betreffende Textstelle in Übersetzung bei F. Risch, Johann de Plano Carpini, Leipzig 1930, S. 119 f., zitiert bei W. Franke, China und
Abendland, S. 10). Kitai ist abgeleitet vom Namen des wohl tungusischen Stammes der Ki, die 916-1124 als Liao-Dynastie Nordchina beherrschten. Kitai oder Katai/Cathay wurde die allgemein übliche
mittelalterliche Bezeichnung für China bzw. den Mongolenstaat im Fernen Osten, populär gemacht natürlich durch die Reisebeschreibungen Marco Polos.
Diese recht ansehnliche Fülle von Namen für ein einziges Land trug keineswegs nur zur Kenntnis über dieses Land bei, sondern verbaute
eher den Zugang zu früheren Informationen, da oft nicht klar war, ob man mit den verschiedenen Namen dasselbe meinte. Hier leistete der
flämische Franziskanermönch Wilhelm von Rubruk – der 1253 im Auftrag des Papstes und des französischen Königs Ludwigs IX. zu einer Reise in
den Fernen Osten aufbrach – einen ersten wichtigen klärenden Beitrag, indem er feststellte, daß es sich bei Kitai und dem Land der Serer um ein
und dasselbe handelte (die betreffende Textstelle in Übersetzung bei F. Risch, Wilhelm von Rubruk, Leipzig 1934, S. 169ff., zitiert bei W. Franke, a.a.O., S. 12).
Noch im 17. Jhd. war es aber umstritten, ob das Land Sinae/China – unter diesem Namen (der wohl auf die indischen Sanskritwörter „cina”,
„Cinisthana” zurückgeht) von den Portugiesen Anfang des 16. Jhd. „neu” entdeckt – mit dem mittelalterlichen Kitai/Cathay identisch sei. Diese These wurde erstmals 1575 oder 1576 von dem spanischen
Augustinermönch Martin de Rada vertreten, war aber selbst zu Leibniz`Zeiten noch nicht ganz anerkannt: so erwähnt Leibniz selbst in einem Brief an Kochanski vom Dezember 1691 (AA I 7, S. 488), daß er
nach den Arbeiten des Jesuiten Martinus Martini und des englischen Orientalisten Jacobus Golius von der Identität von China und „Cataja”
überzeugt sei – eine beiläufige Bemerkung, die aber zeigt, daß die Frage noch nicht vollständig ausdiskutiert war.
Wie die beiden Stellen in Kap. 1 und 21 der Novissima Sinica-Vorrede zeigen, war Leibniz selbst jedenfalls an einer möglichst modernen und
exakten Bezeichnung für China stark interessiert – bemerkenswert und verständlich zugleich nach der oben skizzierten Namensvielfalt der Vergangenheit.
Literatur-Nachweis:
W. Franke, China und das Abendland, Göttingen 1962, S. 5 – 37.
Artikel „Serer” und „Sinai” im Kleinen Pauly, Lexikon der Antike, Bd. 5, München 1975.
Artikel „Seres” in RE IIA 2 (1923), Sp. 1678 ff.
Artikel „China” im Reallexikon für Antike und Christentum, Bd. 2, Stuttgart 1954, Sp. 1078ff.
[12] Jetzt regierender Herrscher. Zar Peter der Große (1689-1725)
war zwar bereits seit dem Tode seines Halbbruders Fjodor (1682) formell zusammen mit seinem Bruder Iwan Zar, stand aber unter der Regentschaft seiner Halbschwester Sofja Aleksejewna, die er
erst Ende 1689 beseitigen konnte. S. unten Anm. 26 S; 123. Beim Erscheinen der Novissima Sinica befand sich Peter der Große (inkognito als Mitglied einer russischen Gesandtschaft) auf Reisen
zu den europäischen Höfen und anschließend nach Holland und England, wo er sich zum Schiffsbau-Ingenieur ausbilden ließ.
Peter der Große sollte später im Leben von Leibniz noch eine große Rolle spielen. In mehreren Denkschriften machte ihm dieser Vorschläge für
die Mittler-Rolle Rußlands zwischen dem Westen und China, für den kulturellen Aufbau und die Bildungs-Organisation des Landes, für die Erforschung Sibiriens, für die Erforschung der geographischen
Zusammenhänge zwischen der Ostspitze Sibiriens und Amerikas (in Vorwegnahme der späteren auf Veranlassung Peters des Großen Forschungsreise von Vitus Jonassen Bering, der 1728 die nach ihm
benannte Beringstraße entdeckte), war der Initiator der späteren Russischen Akademie der Wissenschaften und hatte mehrere Begegnungen mit Peter dem Großen, begleitete ihn auch auf einer Reise
durch Deutschland und wurde durch Erlaß des Zaren vom 1. 11. 1712 russischer „Geheimer Justizrat”. Grundlage ist immer noch das 1873 in
St. Petersburg und Leipzig erschienene Buch von W. Guerrier, Leibniz in seinen Beziehungen zu Rußland und Peter den Großen, der das gesamte
Material einschließlich der Konzepte der Denkschriften von der Hand von Leibniz und aller einschlägigen Briefe aus dem Nachlaß, der sich in der
Niedersächsischen Landesbibliothek in Hannover befindet, veröffentlicht hat. S. außerdem R. Witsram, Peter der Große, Der Eintritt Rußlands in die Neuzeit, Berlin 1954.
[13]Unterstützender Patriarch. Das Haupt der von Rom
unabhängigen russisch-orthodoxen Kirche war zu dieser Zeit der Patriarch Adrian in Moskau. Peter der Große war bestrebt, den Einfluß des Patriarchen immer mehr zu verringern. Praktisch
unterstellte er bereits 1700 das Patriarchat dem Staat und ersetzte es 1721 auch formell durch die Synode.
[14]Zahl seiner Bewohner. Nach Michel Cartier, Artikel
„Bevölkerung” im China-Handbuch Düsseldorf 1974, S. 133-138 (mit weiteren Literaturangaben), betrug die Bevölkerung in China um 1300 n.d.Z. etwa 100 – 120 Millionen, davon 40 % in den
Südprovinzen, um 1700 waren es 140 Millionen, 1830 400 Millionen, 1953 582 Millionen, und heute sind es 950 Millionen bis 1 Milliarde Menschen. Der Bevölkerungszuwachs ist sicher für die
Zukunft Chinas eines der entscheidendsten Probleme, da Produktion, Häuserbau, Infrastruktur usw. eine Bevölkerungszunahme von 12-14 Millionen Menschen jährlich nur
unter großen Anstrengungen bewältigen können.
Leibniz hatte eine noch größere Zahl der damaligen Bevölkerung Chinas im Auge. Wir zitieren aus dem Brief des gelehrten Antwerpener Jesuiten
Daniel Papebroch an Leibniz vom 11. 8. 1687 (Akademie-Ausgabe I, 4, S. 646 Nr. 542; Übersetzung aus dem Lateinischen): „In ganz China versorgen höchstens 30 Patres 200 und mehr in diesem einen
Jahrhundert von ihnen errichtete Kirchen und ungefähr 24000 Christen, die in diesen Kirchen zusammenkommen und durch jenes ungeheuer riesige Reich verstreut sind. Eine große Anzahl, wenn man den
zahlenmäßig geringen Einsatz vergleicht; aber noch jene Zahl bedeutet eine beklagenswerte Winzigkeit in diesem Land, wo außer Frauen und
Kindern mehr als 58 Mio. Männer gezählt werden.” Zählt man Frauen und je zwei Kinder hinzu, so kommt man bereits auf mehr als 200 Mio. Menschen in China in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts.
Bemerkenswert ist, daß Papebroch eine „Zählung”, nicht eine „Schätzung” erwähnt.
Zum Vergleich sei bemerkt, daß nach Buchholz in Bevölkerungs-Ploetz 1955, III S. 15 die Bevölkerung Europas für 1650 etwa 100 Mio.,
diejenige ganz Asiens damals 300 Mio. Menschen betragen haben soll.
[15] contemplatione formarum, übersetzt mit „Erfassung der
Formen”, und zwar in der von Leibniz beabsichtigten Anlehnung an Aristoteles (384 – 322 v.d.Z.), bei dem die Form im Gegensatz zum Stofflichen das innere Wesen und als solches die Ursache der
äußeren Gestalt ist. Im Gegensatz zur platonischen Idee ist bei Aristoteles die Entelechie die Form, die sich im Stoff verwirklicht = Energie, die im Organismus liegende Kraft, die den Stoff von innen
heraus zur Selbstentwicklung und -vollendung bringt. Dementsprechend bezeichnet Aristoteles (de anima II 1 412a) die Seele als die erste Entelechie eines organischen, lebensfähigen
Körpers. Von Leibniz wird der aristotelische Gedanke in seinen Nouveaux Essais und schließlich in seiner Monadologie weiterentwickelt.
[16] Geometria. Wir haben stets mit Mathematik übersetzt, obwohl
uns bekannt ist, daß zu Zeiten von Leibniz der Begriff der der Geometrie übergeordneten Mathematik sich noch nicht überall durchgesetzt hatte. Zur reinen Mathematik im heutigen
Wissenschafts-Verständnis gehören die Algebra, Zahlentheorie, Analysis, Geometrie, Topologie, Mengenlehre und Grundlagenforschung. Während bei den Missionaren zumeist
angewandte Mathematik getrieben wurde, haben wir „Geometrie” im Sinne eines Zweiges der reinen Mathematik mit dem Oberbegriff Mathematik übersetzt.
[17] Homo homini lupus. Die wohl früheste Verwendung dieses
sprichwörtlich gewordenen Satzes findet sich bei dem römischen Komödiendichter Plautus (3./2. Jhd. v.d.Z., gestorben 184 v.d.Z.) in seiner Komödie „Asinaria”, V. 495. Möglicherweise geht der Satz
aber auf griechische Komödien zurück, die Plautus als Vorlage dienten.
[18] Höflichkeitspflichten. Es ist ganz erstaunlich, wie sehr Leibniz
lediglich auf Grund der Beschreibungen der Jesuiten ohne eigene Erfahrungen in den Kern der chinesischen Höflichkeitszeremonie eingedrungen ist. Wir haben die Höflichkeit, die auch heute noch
jede Begegnung mit Chinesen in China selber oder im Auslande durchdringt, als „Herzenshöflichkeit” bezeichnet, die mehr ist als innere Form. Vgl. auch Reinbothe, Verhalten in China, in:
Wirtschaftspartner China, Institut für Auslandsbeziehungen, 3, Stuttgart 1973, S. 115-11T.
[19] Mandarinen. Nach Brockhaus ist die Herkunft des Wortes
unsicher, ursprünglich portugiesische Bezeichnung für einheimische Würdenträger in Hinterindien, dann europäischer Name für chinesische Staatsbeamte (chines. Kuan). Es gab 9
Ränge. Mitglieder der drei obersten Ränge, die zumeist die höchste Staatsprüfung bestanden haben mußten, gehörten der Zentralregierung als Leiter der sechs Ministerien oder dem
Staatsrat an oder hatten andere führende Stellungen in der Zentral- oder den Provinzialregierungen. Die Beamten hatten eine Schlüsselstellung zwischen dem Kaiser und der politischen
Führungsschicht der lokalen Gemeinden, standen gesellschaftlich in hohem Ansehen und genossen Privilegien. Nach Endymion Wilkinson, Artikel „Beamte” im China-Handbuch, soll die Zahl aller
Beamten in der Mitte des 19. Jahrhunderts 20000 auf dem zivilen und 7000 auf dem militärischen Sektor betragen haben und erst nach der Taiping-Revolution auf 150000 angestiegen sein, im
Verhältnis zu der Größe des Reiches eine geringe Zahl. Allerdings sind die lokalen Angestellten (ohne Beamtenrang) nicht mit eingerechnet. Mehr als die Hälfte der Beamten waren Beamte „zur
Beaufsichtigung der Beamten”, erst die 2000 Kreisbeamten waren Beamte „zur Beaufsichtigung des Volkes”.
Theoretisch stand die Beamtenlaufbahn allen offen, wenn sie nur die drei Prüfungen (s. Anm. 25) bestanden, praktisch war sie in den früheren
Zeiten ein Monopol der lokalen Gentry, deren etwa unfähige oder ungeeignete Mitglieder zumeist an den Prüfungen scheiterten. Die Gentry
stand also hier unter einer ständigen Bewährungsprobe. Ihre Einrichtung brach letzten Endes auch den Einfluß aller lokalen oder provinziellen
Machtgruppen, da der Beamte immer dem Kaiser verpflichtet war. Das chinesische Beamtentum (wie auch die Prüfungen) wurden im Aufklärungszeitalter des Westens das Vorbild für das Berufsbeamtentum
mit seiner ethischen Bindung an die überpersönliche Einheit des Staates, der auf den Macht-, Wohlfahrts- und Rechtsgedanken der Aufklärung gegründet war. Besonders England wurde durch die Chinesen in der
Entwicklung seiner bekannten tüchtigen geräuschlosen Bürokratie gerade in Indien und anderen Ländern von den Chinesen beeinflußt. Eine umfassende Geschichte und Darstellung dieser Einflüsse haben wir
bisher nicht ermitteln können, wahrscheinlich muß sie erst geschrieben werden.
[20] Ko-lao – Staatsrat = Mitglieder des Rates der Ältesten, des
Nei-Ko. Den Staatsräten unterstanden sechs Staatsministerien, und zwar a) das Li Pu – Innenministerium mit Jurisdiktion über sämtliche Beamten des Reiches, von dem Jesuiten de Magalhaes
1688 mit 13647 Zivil- und 18520 Militärbeamten angegeben, b) Hu Pu – das Finanzministerium, c) Li Pu – das Kultusministerium. Zu den untergeordneten Behörden gehörten die Ämter für das
Fremdenwesen und für die ausländischen Gesandtschaften, d) Ping Pu – Wehrministerium, e) Hsing Pu – Justizministerium, f) Kung Pu – Ministerium für öffentliche Arbeiten, in dem Jesuiten
öfters als technisch anerkannte Fachleute die Leitung oder Stellvertretung übernahmen.
An der Spitze jedes Ministeriums standen Minister, denen Stellvertreter und Beisitzer beigegeben waren. Vgl. hierzu George H. Dunne, Das
große Exempel, die China-Mission der Jesuiten, Stuttgart 1965, S. 74, sowie Ulrich Hammitzsch und Oscar Weggel, Artikel „Zentralregierung” im China-Handbuch, Düsseldorf 1974, S. 1611-1620 mit
Literatur-Angaben.
[21] Nach Auskunft von M. Boetzke, Theatermuseum des Instituts
für Theaterwissenschaft der Universität zu Köln, handelt es sich wahrscheinlich um die Stegreif-Komödie „Arlequin, Empereur dans la Lune” von N. de Patouville, die zuerst am 5. 3. 1684 in Paris
aufgeführt wurde. In der letzten Szene erzählt Harlekin, der sich als angeblicher Kaiser des Mondes verkleidet hat, um besser auf Brautschau gehen zu können, von den üblen Seiten des
Mondlebens, wobei Kolumbine (die weibliche Standardfigur der Harlekinstücke) jedesmal kurz dazwischenruft: „C`est tout comme ici” – das ist ja alles wie hier bei uns. Möglicherweise hat Leibniz
eine Aufführung des Stückes in Celle nach 1690 gesehen. Jedenfalls war das Stück weit verbreitet und allgemein bekannt, wenn Leibniz so ohne weiteres gegenüber seinen
zeitgenössischen Lesern darauf anspielen kann.
[22]K`ang-hsi (1654 – 1722), der 2. Mandschu-Kaiser, der bereits
als Vierzehnjähriger (1667) die Regierung übernahm. Er ist die zentrale Figur der Betrachtungen von Leibniz, der ihn vielleicht aufgrund der Beschreibungen der Jesuiten etwas überzeichnet
sah – immerhin wollten die Jesuiten ja bei ihm auch für das Christentum ihre Ziele erreichen. Aber er ist tatsächlich auch eine der bemerkenswertesten Persönlichkeiten der chinesischen
Geschichte mit einer der längsten Regierungszeiten. Hervorzuheben sind seine Aufgeschlossenheit für alle geistigen Bestrebungen, auch gegenüber der westlichen Wissenschaft wie
Mathematik oder Astronomie, seine Weitsicht und Sorgfalt z. B. in der Vorbereitung der Verhandlungen mit den Russen bei Nertschinsk – s. unten S. 100 – oder der Organisierung der
Regulierungsarbeiten am Huangho und am Kaiserkanal, die er selber vorbereitete und überwachte. Oder die von ihm stets sorgfältig vorbereiteten militärischen Expeditionen gegen Rebellen
oder die mongolischen Ölöd. Seine Unvoreingenommenheit gegenüber den Jesuiten und seine Dankbarkeit für ihm einmal erwiesene Dienste muß besonders hervorgehoben werden.
Schließlich ist auch das Toleranz-Edikt vom 22.3. 1692, das den Christen freie Mission gewährte, u. a. auf diese Dankbarkeit – einem echt chinesischen Zug – zurückzuführen. Geradezu rührend
muten seine Bestrebungen an, die Zänkereien und Streitigkeiten unter den Missionaren zu schlichten, selber an derartigen Auseinandersetzungen teilzunehmen und sogar durch
Gesandtschaften den Papst in Rom zu einem die chinesischen Belange berücksichtigenden Verhalten zu beeinflussen. Seine Nachgiebigkeit und Duldsamkeit den Jesuiten gegenüber ging so
weit, daß sein ihm nachfolgender wesentlich realistischer eingestellter Sohn Kaiser Yung Cheng mehreren Jesuiten in einem Gespräch sagen konnte: „Der Kaiser, mein Vater, verlor zu einem
großen Teil seinen Ruf durch seine Leutseligkeit, mit der er Euch (d. h. die Jesuiten) gewähren ließ. Die Gesetze Eurer alten Weisen lassen keine Änderung zu und ich habe nicht die Absicht, meine
Regierung mit derartigen Dingen zu belasten.” Zitiert aus Arnold H. Rowbotham, Missionary and Mandarin, the Jesuits at the court of China, Los Angeles 1942, S. 178.
[23]Annalen sind Jahrbücher, in denen die geschichtlichen
Ereignisse (der Gegenwart) in zeitlicher Reihenfolge für die Nachwelt aufgezeichnet werden. Sie waren bereits im alten Ägypten, Assyrien, bei Juden, Römern und Javanern gebräuchlich,
sind aber am weitesten ausgebildet worden von den Chinesen. Die erste vollständige Chronik ist in den im 1. Jahrhundert v.d.Z. aufgezeichneten Frühling- und Herbst-Annalen Tsch`un-ts`in
vorhanden (die von vielen Autoren Konfuzius zugeschrieben werden). Sie umfaßt die Zeit 722 – 481 v.d.Z., ist aber unter moralisch-philosophischen Maßstäben zusammengestellt. Das
Tsch’un-Ts’in wurde für die Tschou-Zeit von dem Ku’ki Shu-ching (Buch der Urkunden) und den drei Ritualwerken Li-chi, Chou-li und I-li fortgesetzt. Den Abschluß bilden die „Denkwürdigkeiten” des
Historiographen (Shi-chi) Ssu-ma T’an und seines Sohnes Ssu-ma Ch’ien. In der 2. Hälfte des 1. Jhd. n d.Z. erscheint sodann die von Pan Ku verfaßte Geschichte der Han-Dynastie (Han-shu). Bereits in
der T’ang-Dynastie wurde 629 n.d.Z. das Historiographenamt (shih-kuan) eingerichtet, später der Han Lin-Akademie angegliedert. Damit begann die Institutionalisierung der amtlichen
Geschichtsschreibung, von Beamten ausgeführt. Es sammelt alle Materialien über die Begebenheiten der Zeit, für die zukünftige Abfassung der Geschichte der herrschenden Dynastie, ist also
gleichzeitig das Reichs-Archiv; es verfaßt Tagebücher über alle Äußerungen und Handlungen des Kaisers; die in den Audienzen zur Sprache gebrachten Angelegenheiten; die kaiserlichen
Audienzprotokolle; Aufzeichnungen der laufenden Regierungsangelegenheiten, verarbeitet zu täglichen Berichten und „Wahrhaftigen Aufzeichnungen” = Regesten. Es wurde auch
bereits eine Aufteilung nach Sachgebieten vorgenommen:
- Religion und Rituale einschließlich Musik, Opferhandlungen und Gewänder,
- Naturwissenschaften (Kalender, Astronomie, die Fünf Elemente, kosmische Vorgänge und außergewöhnliche Erscheinungen),
– Regierung und Verwaltung (Behörden-Verwaltungsorganisation, Bewässerungs- und Kanalwesen, Staatswirtschaft und Rechtswesen).
Daneben gab es Regional-Chroniken für die Provinzen, Präfekturen, Departments und Kreise mit Biographien der bedeutendsten Persönlichkeiten, topographische Beschreibung
der Gebiete, historische und wirtschaftliche Entwicklung, militärische Ereignisse, Siedlungsvorgänge, Bevölkerungsstatistik usw. Man zählt über 6000 Regionalbeschreibungen. Diese
Chroniken bieten unmittelbar oder in literarischen Bearbeitungen gleichzeitig den Hauptteil der später so beliebten chinesischen „Roman”-Literatur und sind zugleich Hauptfundstelle für Therqen
und Texte der meisten klassischen chinesischen „Opern” Pekings wie auch anderer Provinzen. Die Denkwürdigkeiten Ssu-ma Tans und die Geschichte der Han-Dynastie wurden Vorbild für die 22
folgenden Dynastie-Geschichten oder Standard-Geschichtswerke (ed. 1739).
Literatur-Nachweis:
Otto Franke, Geschichte des Chinesischen Reiches in 5 Bänden, Berlin 1930 – 1952; Wolfgang Franke, Artikel „Geschichtsschreibung” im China-Handbuch, Düsselforf 1974 mit Literaturangaben.
Nach Wolfgang Franke a.a.O. ist es beachtenswert, in wie hohem Grade die Historiographen bei aller Abhängigkeit vom Geist ihrer
Zeit und den Wünschen der herrschenden Regierung in der Regel um eine unvoreingenommene und sachliche Darstellung der Ereignisse bemüht waren. Wir haben im Westen dem,
insbesondere aus neuerer Zeit, nichts entgegenzusetzen. Einrichtungen wie das deutsche „Archiv der Gegenwart” bemühen sich durch Dokumentation und Chronik um eine objektive zeitliche
Schilderung der Ereignisse in allen Ländern der Erde, ohne jedoch ein „Archiv” im wörtlichen Sinne unterhalten zu können. Das Bundesarchiv in Koblenz sammelt nur für die Bundesrepublik
Deutschland, verarbeitet aber nicht. Zur Verarbeitung der Überflut von Informationen und Literatur auf dem kulturellen und wissenschaftlichen Gebiet ist neben Fach-Archiven und
-speicherungen auch eine Sammlung nach Ländern, insbesondere aber zur Förderung des Kultur-Austausches China-Bundesrepublik, dringend erwünscht. Beschränkt zunächst
auf Naturwissenschaften und Technologie einschließlich Medizin, beginnt die VR China in Wuhan und anderen Universitäts-Städten besondere Sammel- und Informations-Stellen über die laufende
ausländische Literatur (Bücher und Zeitschriften) einzurichten; ob auch bereits für die Geisteswissenschaften, ist nicht bekannt. Es ist auch nicht bekannt, ob und in welchem Umfange die früher
übliche Geschichtsschreibung von einem neuen Historiographenamt fortgesetzt wird. Dafür spricht allerdings, daß nach neuesten Nachrichten auch die alte chinesische Tradition der
Enzyklopädien – seit dem 2. Jhd. veröffentlichte „Kategorien”-Bücher (lei-shu) = im amtlichen Auftrage geschriebene und nach Sachgebieten eingeteilte
Nachschlagewerke – von der VR China wieder aufgenommen worden ist. Es sollen zunächst Zusammenstellungen für die einzelnen Sachgebiete veröffentlicht werden.
[24] Bürokratie. Zu den obersten Behörden vgl. Anm. 20. Die
chinesische Bürokratie hat in den mehreren tausend Jahren der chinesischen Geschichte eine Reihe von Eigenarten entwickelt, die sie von denjenigen des Westens unterscheidet. Wie Max Weber,
Wirtschaft und Gesellschaft, S. 823 ausgeführt hat, hat China überwiegend eine Art von „Kultur-Beamten” herangebildet, dem im Gegensatz zum Westen Spezialistentum fremd war. Die
Rekrutierung der Beamten aus den führenden Familien blieb vorherrschend und ist auch heute noch in China dem Vernehmen nach nicht überwunden. Die Vereinheitlichung der Schrift ist
letzten Endes aus den Bedürfnissen der Bürokratie entstanden. Die Formen des gegenseitigen Verkehrs der einzelnen Behörden und Dienststellen war genau schriftlich festgelegt, sie blieb dem
Schriftverkehr vorbehalten, mündliche Entscheidungen gab es nicht. Es entwickelte sich die Tendenz der Bürokratie, sich hinter dem schriftlichen Formalismus zu verschanzen und eine eigene
Verantwortung möglichst zu vermeiden, wobei auch die – noch heute beobachtete – Übung beitrug, Schriftstücke und Erlasse möglichst nicht mit Namen zu unterschreiben, sondern lediglich zu
stempeln oder zu siegeln. Hinzu kommt der chinesische Zeitbegriff und die Neigung, Entscheidungen aus dem Wege zu gehen und zunächst erst einmal alles zu diskutieren.
Der chinesische Staat war also ein Beamtenstaat. Die Eigenständigkeit von sozialen Gruppen wurde nicht anerkannt. Das Land wurde von oben
regiert. Die endlose Verschleppung von Entscheidungen wurde von der Bevölkerung immer wieder kritisiert, jedoch kaum geändert. Das Gefährliche ist, daß sich die alte Tradition der chinesischen Bürokratie
nunmehr auch in den Betrieben und Wirtschaftsverwaltungen festgesetzt hat, sehr zum Schaden schneller, effektiver Entscheidungen. Während
die westliche Bürokratie durch immer mehr verfeinerte Vorschriften mit Rechtsstaatsgarantien auch für den einzelnen versehen wurde und eine
Überprüfung aller Verwaltungs-Entscheidungen durch die Verfassung (das Grundgesetz) garantiert ist, fehlt es in China immer noch an der
Ausbildung eines Verwaltungs- und eines richterlichen Prüfungsrechts, allen Grundsätzen der neuen Verfassung zum Trotz, die wenigstens für den einzelnen die Möglichkeit von Eingaben, Beschwerden an die
höheren Dienststellen, Petitionen usw. grundsätzlich geschaffen hat, ohne allerdings für ausreichende Realisierung zu sorgen.
Die pessimistische Voraussage von Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, S. 842, daß die modernen Staaten letzten Endes an der
Überwucherung ihrer Bürokratie zugrunde gehen werden, teilen wir nicht. Allerdings wird es hier großzügiger Reformen bedürfen, im Westen
wie in China, jedoch mit verschiedenen Inhalten und Zielsetzungen, die sich aus der unterschiedlichen Geschichte und gesellschaftlichen Struktur
des Westens und Chinas ergeben. Siehe im übrigen auch den Artikel „Bürokratie” von Hammitzsch, China-Handbuch, S. 187-190 mit Literaturangaben. Eine wissenschaftliche Phänomenologie der
chinesischen und auch der westlichen Bürokratie unter Einbeziehung ihrer Geschichte und gegenseitigen Beeinflussung und gegenseitigem Vergleich wäre nach unserer Auffassung erforderlich, zumal von einer
Reformierung auf beiden Seiten die weitere gesellschaftliche Entwicklung wesentlich abhängig ist. Als Phänomene seien genannt: in China der
Obrigkeitsgedanke, der das gesellschaftliche und politische Gefüge zusammenhält, die Selbstbehauptung des Einzelnen gegenüber der Obrigkeit, der vertikale Zentralismus, der eine Zusammenarbeit der
Behörden auf horizontaler Ebene erschwert, der schriftliche Formalismus, der eine mündliche oder telefonische Entscheidung nicht zuläßt, die
Beamtenhierarchie, die den Untergebenen nicht zu Wort kommen läßt; im Westen das Überziehen des gesamten öffentlichen Lebens mit staatlichen, halbstaatlichen, privaten Verbands-Apparaten, das
Bestreben dieser Apparate zu Verselbständigung, Eigenmacht und Ausdehnung, der Perfektionismus, der alles mit Bestimmungen regeln will, die Überheblichkeit des auf speziellen Fachgebieten tätigen
Beamten, der alles besser weiß, das mangelnde Informationsrecht des Einzelnen, die mangelnde Transparenz der Apparate, die zunehmende Ohnmacht des Einzelnen, sich gegenüber der verbeamteten
Offentlichkeit noch zu Gehör zu bringen, die Lähmung der Initiative des einzelnen Staatsbürgers in öffentlichen Angelegenheiten.
[25] Prüfungen. Das chinesische Prüfungssystem geht zurück auf
die Bestrebungen der Han-Kaiser (206 v.d.Z. – 220 n.d.Z.), ihre Macht nicht auf den erblichen Adel, sondern eine ihnen ergebene, qualifizierte Beamtenschaft zu stützen. Das Prüfungssystem, das
bis 1904 unverändert beibehalten wurde, kannte Vorexamen in den Kreishauptstädten und Präfekturen und eine Hauptprüfung in Peking, Prüfungen, die alle drei Jahre stattfanden, und zwar in
Peking unter Vorsitz des Kultusministers und zuletzt des Kaisers, wobei das Bestehen der Hauptprüfung die Einberufung in höchste Staatsämter nach sich zog. Jede Prüfung bestand in einer
größeren Zahl von Aufsätzen in Prosa und in Versen, deren Themen und sprachliche Formalia den klassischen Schriften entnommen waren. Die Ausdehnung auf naturwissenschaftliche,
mathematische Fächer oder ausländische Angelegenheiten wurde noch im 19. Jahrhundert abgelehnt. Verbindlicher Maßstab hierbei war der Konfuzianismus. Der Mandarin sollte in erster Linie ein an
der klassischen chinesischen Literatur gebildeter Humanist sein, vor allem bei der Ausübung seiner Dienstobliegenheiten, wobei er die Tagesarbeit seinen Kanzleibeamten überließ. Max Weber
nennt ihn in „Wirtschaft und Gesellschaft” (S. 823 ff.) schlicht „Kultur-Beamten” im Gegensatz zu dem im Westen ausgeprägten „Fach-Beamten”, der stets Spezialfunktionen selber auszuüben
hat und seine Ausbildung im Wesentlichen in spezialisierten Fachbereichen erhält.
[26]Schriftzeichen. Die chinesische Bilderschrift, zunächst
gegenständlich entstanden (als Abbild von Gegenständen, wenn auch in abstrakter Zeichnung), später den Gegenstandswert aufgebend, drückt ganze Worte (mit ihrem Begriffs-, Gefühls- und
sinnlichen Umweltsbezug) aus im Gegensatz zu der westlichen Buchstaben-Schrift. Die Aneinanderreihung von Worten ohne Beugung (Deklination) und unter Verzicht auf viele bei uns
vorhandenen Partikel verführt bereits in ihrer Anlage zu dichterischen Kombinationen. Die von der Hand (mit Tusche) geschriebene Schrift vermag durch den Duktus des Pinsels, die
verschiedene Breite der Bestandteile der einzelnen Zeichen usw. den persönlichen Ausdruck des Schreibers in ganz anderer Weise zu vermitteln, als es die mechanische Typisierung und stete
Wiederholung der einmal (früher) in Holz geschnittenen, jetzt in Metall gegossenen Schriftzeichen vermag. Persönlich gehaltene und geschriebene Äußerungen in hymnischer oder Gedicht-Form
waren stets in China der Ausdruck bedeutender, auch offizieller Persönlichkeiten, die regierenden Kaiser nicht ausgenommen. Wir verweisen z. B. auf die von Mao Zedong selbst geschriebenen und
verfaßten Gedichte – deutsche Übertragung bei Schickel, Mao Tse-tung, 37 Gedichte, München 1979, oder auf den in der Öffentlichkeit vollzogenen Gedicht-Wechsel zwischen Mao und Kuo
Mo-jo. Bereits die Nestorianische Stele (s. S. 127) erzählt uns von vom Kaiser selber geschriebenen Widmungen, die in den nestorianischen Kirchen aufgestellt wurden. Die intuitive
Erfassung dieser Phänomene durch Leibniz an der vorliegenden Stelle ist besonders bemerkenswert.
Zur Literatur verweisen wir auf die Artikel „Schrift und Schriftreform” und „Schriftkunst”, Zdenka Hermanova-Novotna und Lothar Ledderose im
China-Handbuch, S. 1177 – 1188 mit Literaturangaben. Das bei uns gebräuchliche Wort „Kalligraphie” betont lediglich die ästhetische Seite und gibt die Bedeutung des Handgeschriebenen in China – schon das
Wort „Kunst” ist trügerisch – nur unzulänglich wieder. Die Tatsache, daß Alt und Jung in zahlreichen Ausstellungen alte und neue handgeschriebene Texte studieren, vergleichen und bewundern, zeigt die
Bedeutung, die „Handschriften” für Chinesen aller Schichten auch heute noch besitzen.
[27]Das hier von Leibniz angesprochene Bittgesuch, an dem Kaiser
K’ang-hsi selbst maßgeblich beteiligt gewesen sein soll, wurde den Pekinger Jesuiten laut Soares` Bericht (3. Kapitel des 2. Teils, in der 2. Auflage der Novissima Sinica von 1699 auf S. 103 f.) am
1. Januar 1692, also nur wenige Monate vor dem eigentlichen Toleranzedikt, vorgelegt.
[28] Schall von Bell, Johann Adam = T’ang Jo-wang, Tao-Wei 1592
Köln (im Laach am Neumarkt) – 1666 in Peking. Deutscher Jesuit. Der Name „von Bell” stammt von dem Rittergut Horbell (Marsdorf bei Köln), das heute noch existiert. Von Macao (Ankunft 1619)
ging er zunächst nach Xi’an (1627 – 1630), wurde 1630 zur Kalenderreform nach Peking berufen und nach glänzend bestandenem Wettstreit mit den bisherigen chinesischen und
arabischen Astronomen von Kaiser Chun-shih 1645 zum Leiter der Obersten Mathematischen Behörde berufen. Er wurde Mandarin des 5., später des 1. Grades. Er erbaute die Kirche Nan t’ang im
Süden der Verbotenen Stadt, die nach mehrfachen Zerstörungen immer wieder aufgebaut wurde, heute noch besteht, zur Zeit von den Lazaristen verwaltet wird und von dem Verfasser Ende April
1979 in Peking besucht wurde. In dem Nebenhaus befand sich bis zur Kulturrevolution die mehr als 6500 Bände umfassende, bereits von Ricci begründete Bibliothek mit wertvollen Drucken des 16.
und 17. Jahrhunderts, über die Mitte des 19. Jahrhunderts ein umfassender gedruckter Katalog herauskam. Während der Kulturrevolution wurde die Bibliothek in die Chinesische
Nationalbibliothek in Peking überführt, wo sie sich wahrscheinlich noch heute befindet und westlichen Wissenschaftlern zugänglich gemacht werden sollte. Auf Grund von Intrigen wurde Schall
zusammen mit Verbiest und anderen 1664 ins Gefängnis geworfen und zum Tode verurteilt, aber nach zwei Jahren wieder befreit. Erschütternd ist sein Schuldbekenntnis, das er kurz vor
seinem Tode Verbiest diktiert und mit vom Tode gezeichneter Hand noch selbst unterschrieb, wiedergegeben in der umfassenden und auch heute noch nicht überholten Biographie
von Alfons Väth, Köln 1933, S. 316f.
Schall wurde nach seinem Tode vom Kaiser K’ang-hsi in seine früheren Würden wieder eingesetzt und voll rehabilitiert. Zu seinem Grab steuerte
der Kaiser wie auch sein Vorgänger schon bei Matteo Ricci bei. Beide Grabanlagen wurden im Boxeraufstand 1900 zerstört. Schall hat eine Reihe theologischer, mathematischer, astronomischer Werke – zumeist
in chinesischer Sprache – hinterlassen. Das von Matteo Ricci mitgebrachte Cembalo fand er verstaubt und vergessen in der kaiserlichen Schatzkammer vor, hat es wieder instandgesetzt, dem
Kaiser vorgespielt und auch wie Ricci für das Cembalo komponiert; seine Kompositionen sind ebenfalls erhalten. Über sein Leben hat Schall in einem Tagebuch berichtet. Leider gibt es bis heute keine
wissenschaftliche Ausgabe dieses Tagebuches (nur Bearbeitungen), und auch keine wissenschaftliche Gesamt-ausgabe seiner Werke und Briefe.
[29] Tataren. Zunächst die umfassende Bezeichnung der
Völkerschaften der von Dschingis Khan (1155 – 1227) und seinen Nachfolgern begründeten Reiche: erste den Westen erreichende Botschaften über die von den vorstürmenden Horden verübten
Greuel sprachen in Anlehnung an die griechische Mythologie von den „aus der Hölle losgelassenen Hunden des Tartaros”, daher auch „Tartaren”-Nachricht (vgl. Gabriel Ronay, The Tartar Khan’s
Englishman, London 1978); nach dem Zerfall der „Goldenen Horde” (letzte Schlacht 1502) wurde der Begriff Tataren auf die Völker Zentralasiens einschließlich der Mongolen und später auch
auf die Sibiriens ausgedehnt. Auf den Karten Chinas – z. B. von Martini im Novus Atlas Sinensis Köln 1655 – wird das Gebiet nördlich von Peking und der Großen Mauer, d. h. die heutige
Mandschurei, als „Tartarey” bezeichnet. Schall und Verbiest sprechen vom Imperator „Tartaro-Sinicus”-Kaiser K’ang-hsi als dem „tartarischen und chinesischen” Kaiser. Verbiest überschreibt
seine mandschurische Grammatik „Elementa linguae tartaricae”. S. Anm. 4.
[30] Le Comte, Louis Daniel = Li Ming Fou Tch’ou 1655 (Bordeaux) –
1728 (Bordeaux) Franzose, Jesuit, Astronom, Naturforscher, Geograph. Er gehörte zu den sechs Missionaren, die von Ludwig XIV. auf Betreiben und unter Leitung des Paters Jean de Fontaney
aus Frankreich nach China geschickt wurden. Auf der Schiffsreise nach China beobachtete er u. a. die Jupiter-Monde, später die Konjunktur von Jupiter und Mars, das Vorbeiziehen des Merkurs
an der Sonne, die Sonnenfinsternis vom März 1687. In Peking, wo er 1688 eintraf, hatte er Unterredungen mit dem Kaiser K’ang-hsi, mit Fontaney kehrte er 1690 über Kanton und Rom nach
Frankreich zurück. Er wurde sodann Beichtvater der Herzogin von Burgund. Sein Hauptwerk sind die Nouveaux Memoires sur l`état present de la Chine, 2 Bände, Paris 1696. Auf seiner Reise nach
Kanton entwarf er eine Karte des Flußsystems zwischen Nanking und Kanton. Er schrieb einen Straßenführer mit allen geographischen Einzelheiten für den Weg von Ning-pouo nach
Peking und von Peking nach Kiang-tschou.
[31] Pilatus` berühmte Frage nach der Wahrheit, vgl.
Johannesevangelium Kap. 18,38 (dicit ei Pilatus: quid est veritas).
[32]Platon und die Mathematik: Ohne hier im entferntesten
Vollständigkeit auch nur anstreben zu können, seien doch einige der Stellen genannt, an denen Platon in seinem umfangreichen philosophischen Werk die Bedeutung der Mathematik bzw. ihrer
Zweigwissenschaften stark hervorhebt und sie an zentrale Positionen seines staatspolitischen Erziehungsprogrammes setzt: Im 7. Buch der „Politeia” bespricht Platon die Erziehung der
wichtigen und privilegierten Schicht der „Wächter” seines Staates. Dabei kommen auch die verschiedenen Zweige der Mathematik zur Sprache, und jedesmal wird festgestellt, daß sie als Führer zur
Wahrheit von großer Bedeutung sind: sowohl Logistik und Arithmetik (Pol. VII 525b1) als auch die Geometrie (527 b 9). Im Dialog „Timaios” (53 b) wird von der Erschaffung des Kosmos
„nach Formen und Zahlen” gesprochen. Ähnlich wie in der „Politeia” behandelt Platon auch in seinem weiteren Staatsentwurf, den „Gesetzen”, die Notwendigkeit
mathematischer Kenntnisse für die politische Führungsschicht (Gesetze VII 817c-etwa 822 d; dabei wird auch die notwendige Kenntnis der Astronomie betont!). Gleichartiges findet sich auch in
der sogenannten „Epinomis” (976e-979 d), bei der die Verfasserschaft Platons heute zwar umstritten ist, die aber in Leibniz` Zeit sicherlich als echt galt. Angeblich soll sogar über dem
Eingang der Akademie, Platons Philosophenschule in Athen, der Spruch gestanden haben: „Niemand soll eintreten, der nicht Kenntnisse in der Mathematik besitzt” (zu finden in zwei
Aristoteles-Kommentaren: Elias in Arist. cat. 118,18; Johannes Philoponus in Arist. de an. 117,19).
[33]Das „eine Auge”. Leibniz versucht hier eine tiefgründige
Methodenlehre zu begründen, um die Unterschiede zwischen chinesischer und westlicher Wissenschaft auf ihre „Ur”-Gründe zurückzuführen: Er unterscheidet zwischen der „exakten”
(westlichen) Wissenschaft und derjenigen der Chinesen, die die exakte Wissenschaft trotz ihrer seit „einigen tausend Jahren” angestrengten Bemühungen bisher nicht erreicht hätten. Als das
„eine Auge” bezeichnet Leibniz die Mathematik, als das „andere Auge” der westlichen Wissenschaft die Metaphysik; s. hierzu auch die nächste Anmerkung. Daß die chinesische „Wissenschaft”
(begründet durch ihre Sprache und Schrift) der westlichen an totaler Erfassung aller Lebenserscheinungen überlegen ist, wird von dem Begründer der Monadologie hier nicht zum Ausdruck
gebracht, wobei sie sich nach Meinung von Needham, Science and Civilisation in China, Band II, S. 496 ff. in ihren Wurzeln gerade u. a. auf die Einsichten von Leibniz in die Kultur Chinas zurückführen
läßt. S. auch David E. Mungello, Leibniz and confucianism, the search for accord, Honolulu 1977, S. 122/123. S. auch unsere Ausführungen im Vorwort S. V über die Notwendigkeit einer
China-Grundlagen-Forschung.
[34]„Erste Philosophie”. Leibniz nimmt hier wieder Bezug auf
Aristoteles (384 – 322 v.d.Z.), der in seinen Büchern in der Reihenfolge „nach der Physik” = Griechisch: „meta ta physika” = die „erste Philosophie” oder Sophia (Weisheit) behandelt und sie
als die Wissenschaft von den ersten Prinzipien und Ursachen verstanden wissen will. S. auch Aristoteles, Metaphysik E 1026a 16. Mit dieser „ersten Philosophie” beschäftigen sich nach wie vor
die moderne Wissenschaftslehre und Metaphysik. S. z. B. Martin Heidegger, Einführung in die Metaphysik, 1953.
[35] Hedraeus = die griechisch-lateinische Übersetzung des
Namens von Pater François d`Aix de la Chaize (1624 – 1709), dem Beichtvater Ludwigs XIV. nach 1675 und einem der Initiatoren der Entsendung einer französischen Mission nach
China. Hedra (griechisch) = „Stuhl” = la chaise.
[36]Verjus = Antoine Verjus (1632 – 1706) stand in lebhafter
Korrespondenz mit Leibniz. Er war Sekretär des Paters de la Chaize, erhielt über ihn wichtige Informationen über die französische China-Mission, die er an Leibniz weitergab.
[37] Zu den Begriffen natürliche Theologie – geoffenbarte Theologie
vgl. O. Roy, Leibniz et la Chine (mit Originalzitaten aus Leibniz` Werken), Paris 1972, S. 45 ff. Unter „natürlicher” Theologie versteht Leibniz eine mehr oder weniger diffuse und noch
unvollständige Erkenntnis Gottes und des Transzendenten. Da der Mensch nicht fähig ist, ganz aus eigener Kraft die „verstandesmäßige”, rationale Theologie zu erreichen, die ihm die
vollkommene Gotteserkenntnis ermöglichen würde, bedarf er der Offenbarung – für Leibniz natürlich speziell der christlichen Offenbarung –, um die vollkommene Theologie zu erreichen. So
wie Leibniz sich hier ausdrückt, sind offenbar beide Komponenten erforderlich, um die rationale Theologie ganz zu verwirklichen. Die „natürliche” Theologie sah Leibniz wohl im chinesischen
Konfuzianismus auf breiter Basis verwirklicht; sie bedarf aber noch der Vervollkommnung durch die christliche Offenbarung. Demgegenüber ist es äußerst bemerkenswert, daß nach Leibniz`
Auffassung umgekehrt Europa ein Defizit an „natürlicher Theologie” aufweist und deshalb auch Chinas bedarf.
[38] Leibniz spielt hier auf das Paris-Urteil an, das in der
griechischen Mythologie eine bedeutende Rolle spielt und dort ein wesentliches Moment für die Entstehung des Trojanischen Krieges war. Auf der Hochzeit des griechischen Helden Peleus mit der
Meeresgöttin Thetis hatte die nicht zum Fest eingeladene Göttin der Zwietracht, Eris, einen goldenen Apfel mit der provozierenden Aufschrift „Der Schönsten!” unter die drei anwesenden Göttinnen
Hera, Athene und Aphrodite geworfen, bei denen daraufhin sofort ein heftiger Streit um diesen Apfel ausbrach.
Man bestellte den trojanischen Königssohn Paris zum Schiedsrichter über die Schönheit der drei Göttinnen, und dieser sprach den Apfel Aphrodite
zu, nachdem sie ihm den Besitz der schönsten Frau der Welt versprochen hatte. Damit war sowohl der spätere Raub der schönen Helena vorprogrammiert – der Anlaß für den Trojanischen Krieg – als
auch die erbitterte Gegnerschaft, die Hera und Athene gegenüber Paris und den Trojanern überhaupt in diesem Krieg an den Tag legten. Leibniz` kurze Andeutung weist darauf hin, daß dieses mythologische
Thema den gebildeten Schichten seiner Zeit wohlbekannt war – sowohl aus der Literatur wie auch aus künstlerischen Darstellungen.
[39] Arnauld, Antoine (1612-1694), berühmter französischer Jurist
und Jansenist. Er bekämpfte erbittert die Methode der Jesuiten und ihren theologischen „Modernismus”, mußte Frankreich verlassen, lebte als Flüchtling in Brüssel und verzehrte sich in
seinen Auseinandersetzungen mit den Jesuiten, Calvinisten und den sich diesen anschließenden Philosophen. S. die 8-bändige Ausgabe seiner Morale Pratique des Jesuites, Köln 1669 – 1694,
Lettres d`un theologien contre la defense des nouveaus chretiens. Die von Leibniz erwähnte „Apologie” ist wohl die von Arnauld 1650 geschriebene Apologie pour les saints Peres de
l`Eglise, in der die Lehre des Augustinus im Sinne Jansens verteidigt wird.
Tavernier, Jean Baptiste (1605 – 1689), ein berühmter französischer Reisender, der am französischen Orienthandel sich beteiligte und
hierdurch reich wurde und auf seinen Reisen den französischen Orienthandel zu fördern sich bemühte. Dies erregte den Argwohn der Holländer, die ihm jede Schwierigkeit in den Weg legten, weil sie für ihre
Handelsmonopole in Indien und Japan fürchteten. Seine „Vierzig-Jährige Reise-Beschreibung” Nürnberg 1681, machte einen großen Eindruck auf
den kurfürstlichen Hof von Brandenburg. Tavernier wurde einer der ersten Leiter der Brandenburgischen Ost-Asien-Kompagnie, die gegründet wurde, aber bereits bald ihre Tätigkeit einstellen mußte, da
sie sich gegen die anderen Kolonialmächte und deren Gesellschaften nicht behaupten konnte. Tavernier arbeitete auch für den Großen
Kurfürsten Pläne für Reisen in den Fernen Osten aus, die gleichfalls nicht realisiert werden konnten.
[40] Paulus. Leibniz meint die Stelle im 1. Brief des Apostel Paulus
an die Korinther Kapitel 9 Vers 22: „Den Schwachen bin ich geworden ein Schwacher, auf daß ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, um etliche selig machen zu können.” Vgl.
im griechischen Text: „tois pasin gegona panta hina pantos tinas soso” („damit ich einige völlig in allem retten kann”). Man kann (mit Dunne, a.a.O.) diese Ausführungen des Paulus als die Magna
Charta der Heidenmission überhaupt ansehen, und zwar nicht nur in der hellenistisch-römischen Zeit, als Paulus den Übergang von der Juden-Mission zur Heidenmission bewirkte, sondern auch für
die Auslands-Mission der Neuzeit, so daß Leibniz sich also hier zu Recht auf Paulus beruft.
[41]Im Laufe der 2. Hälfte des 17. Jhd. kam es zwischen England
und den Niederlanden zu einer Reihe von Seekriegen, die sich auch im kolonialen Raum, vor allem aber in der Nordsee und im Englischen Kanal abspielten. Zum ersten englisch-holländischen
Seekrieg kam es 1652, nachdem die 1651 erlassene englische „Navigationsakte” versucht hatte, den holländischen Zwischenhandel zwischen England und dem Kontinent
auszuschalten. Der Krieg endete nach englischen Erfolgen 1654 mit einem Friedensvertrag, doch kam es schon 1664-1667 zur nächsten Auseinandersetzung: in ihrem Verlauf konnten die
Engländer zwar in Nordamerika 1664 Neu-Amsterdam, das spätere New York, sowie die Kolonien New Jersey und Delaware erobern, mußten aber andererseits empfindliche Verluste
hinnehmen, als die holländische Flotte 1667 in kühnem Vorstoß die Themse hinauffuhr und bei Chatham eine große Anzahl englischer Kriegsschiffe verbrannte. In Asien mußte England sich
endgültig aus dem indonesischen Raum zurückziehen (Abtretung des Stützpunktes Poeloe Run), doch wurde die englische Position in Indien stabilisiert. Weitere Rückschläge erlitten die Engländer
auch im Dritten englisch-holländischen Seekrieg 1672/73, als vorübergehend sogar die neugewonnenen nordamerikanischen Kolonien aufgegeben werden mußten. Zu einer ersten
Annäherung zwischen beiden Staaten kam es dann 1677 mit der Heirat zwischen Maria, der Nichte des englischen Königs Karl II., und Wilhelm III. von Oranien, dem Statthalter der Niederlande;
1678 wird ein offizielles Verteidigungsbündnis zwischen England und den Niederlanden geschlossen. Seit 1688, dem Jahr der „Glorious Revolution”, stehen die beiden Länder mit Wilhelm III.
sogar unter einem gemeinsamen Staatsoberhaupt. In dieser Zeit und in der Folge steht England immer auf der holländischen Seite gegen Frankreich, während es vorher meist mit Frankreich gegen
die Niederlande optiert hatte (noch 1672 war England an der französischen Landoffensive gegen Holland beteiligt). Gleichwohl dürften mit der Personalunion die beiderseitigen Rivalitäten in den
Kolonien Süd- und Südostasiens nicht ausgeräumt worden sein. Doch konnten die Niederländer ihre indonesischen Stützpunkte behaupten bzw. ausbauen (s. o.), während England auf den
indischen Raum beschränkt blieb.
Die lobende Einschätzung, die Leibniz von der englischen und holländischen Missionstätigkeit gibt, dürfte wohl etwas zu optimistisch
sein: sowohl Engländer als auch Niederländer waren damals primär an einem lukrativen Handel interessiert. Leibniz hat an anderer Stelle selbst
brieflich das geringe missionarische Engagement der beiden Länder beklagt (vgl. Lach, a.a.O., S. 41).
[42]Sofern nur erst Europa der Friede zurückgegeben ist. Leibniz
denkt nach den Eroberungszügen Ludwigs XIV. – 1693 wurde das Heidelberger Schloß verbrannt – doch wohl an die Große Allianz, die 1697 im Frieden von Ryswijk Frankreich zum Frieden zwingen
konnte, und nicht so sehr an die Türkenkriege, die durch den Frieden von Karlowitz 1697 beendet wurden. Immerhin geben die Angaben von Leibniz Anhaltspunkte für die Datierung der ersten
Druckausgabe der Novissima: sie muß nach dem russisch-habsburgischen Vertrag vom 8. 2. 1697 und vor dem Frieden von Ryswijk vom 20. 9./30. 10. 1697 erschienen sein.
[43]Dieu, Louis de (1570 – 1642) war ein berühmter Orientalist und
Theologe der Universität Leiden. 1639 erschien sein Werk Historia Christi et St. Petri Persice conscripta = eine persische Bibel-Übersetzung.
[44]Abessinien, heute etwa Äthiopien. König Ezana von Aksum trat
350 n.d.Z. zum Christentum über, das er zur Staatsreligion erhob. Unter syrischem und koptischem Einfluß war und blieb die Kirche bis heute monophysitisch, d. h., in der Glaubensformel wurde die
unvermischte Einheit der beiden Naturen in der einen göttlichen Person des Gottmenschen Jesus Christus bekannt. Die christlich-orthodoxe äthiopische Kirche hatte zuletzt etwa 8 Mio.
Gläubige, zahlreiche Kirchen und Klöster. Gegen den anstürmenden Islam rief bereits der Negus Zare Yaqol (1434 – 1468) König Alfons von Portugal um Hilfe an. Papst Eugen IV.
stellte zur Bedingung, daß sich die äthiopische der Katholischen Kirche anschlösse. Statt militärischer Hilfe sandte Portugal zunächst nur Missionare. Erst unter Christofor da Gama (einem
Sohn Vasco da Gamas) kamen portugiesische Truppen dem Kaiser David II. zur Hilfe. Erst unter seinem Nachfolger Kaiser Claudius (1540 – 1559) gelang es mit portugiesischer Hilfe, in der Schlacht
am Tana-See die islamischen Eindringlinge zu besiegen. Die katholischen Missionare gründeten Kirchen und Klöster und gewannen immer mehr an Einfluß. Kaiser Susenyus (1607-1632)
trat sogar zum katholischen Glauben über und versuchte, seine Untertanen und Priester zum Glaubensübertritt zu zwingen. Es kam zu einem blutigen inneren Religionskrieg, in dem der Sohn
des Kaisers Kronprinz Fasiladas die andere Seite führte. Als der Kaiser, der in der Entscheidungsschlacht selber die Reiterei siegreich geführt hatte, die 8000 Toten seiner Kampagne auf dem
Schlachtfeld liegen sah, entschloß er sich, die alte Religion wieder einzuführen mit dem Edikt vom 14.6. 1632:
„Höret! Höret! Höret! Zuerst haben Wir euch den katholischen Glauben vorgeschlagen, weil Wir ihn für gut hielten. Aber eine unzählige Menge
von Menschen ist nun zugrunde gegangen, weil sie gegen diesen Glauben kämpften, unter ihnen Älius, Gabrael, Tekla Georgis, Sertza Christos und schließlich dieses rauhe Bergvolk von Lasta. Deshalb
gewähren Wir euch wieder die Religion Eurer Vorväter. In Zukunft sollen die Priester des alexandrinischen Bekenntnisses wieder ihre Kirchen
betreten, ihre eucharistischen Altäre haben und ihre Liturgie lesen nach altem Brauche. Gehabt euch wohl und freuet euch! Was mich aber
betrifft, so bin ich jetzt alt, durch Kriege und Gebrechlichkeit erschöpft und nicht länger fähig zu herrschen. Ich ernenne meinen Sohn Fasiladas zu meinem Nachfolger.”
[45] Das Zitat aus Verbiests Astronomiebuch: Das von Leibniz fast
wörtlich übernommene Zitat findet sich in der europäischen Ausgabe von Verbiests Buch („Astronomia Europaea sub Imperator Tartaro-Sinico Cam Hy appellato ex umbra in lucem
revocata, a R.P. Ferdinando Verbiest Flandro-Belga e Societate Jesu, Academiae Astronomicae in Regia Pekinensi Praefecto”, Dillingen 1687) auf S. 56f.: „tum ut ostendam, quomodo Uranie
Europaea Regales animos primum dignata sit movere...” („dann um zu zeigen, wie die europäische Muse Urania zum ersten Mal geruht hat, das Herz des Herrschers zu beeinflussen...”). Das
Zitat findet sich auch in Leibniz` Exzerpt des Astronomiebuches in den Novissima Sinica selbst (1. Auf 1. 1697, S. 165; 2. Aufl. 1699, S. 155): „Ita Uranie Europaea Regales animos primum dignata
movere magnam maiorum successuum spem fecit” („So hat die europäische Muse Urania, die zum ersten Mal geruht hat, das Herz des Herrschers zu beeinflussen, große Hoffnung auf noch
größere Erfolge gemacht”). Urania ist unter den neun Musen diejenige der Astronomie. Auch in diesem Fall ist die allgemeine Kenntnis dieser mythologischen Vorstellung beim Leserpublikum vorausgesetzt.
[46] Ricci, Matteo = Li Ma-teou, Si-T’ai. 1552 (Macerata 150 km nö
von Rom) – 1610 (Peking) Italiener, Jesuit. 1583 Kanton, dann Shiuhing, Shiuchow, Nanking, Nantchang, seit 1601 Peking. In Rom war er mehrere Jahre Schüler des berühmten Astronomen
und Mathematikers Christoph Clavius (aus Bamberg stammend), dessen Euklid-Ausgabe 200 Jahre lang als Standard-Lehrbuch für junge Mathematiker diente. Chinesisch begann Ricci in Macao zu
lernen. Man kann Ricci als den größten katholischen Missionar in China bezeichnen, der den Weg für seine Nachfolger überhaupt erst bereitet hat, als erster die Abneigung der Chinesen gegen
Ausländer und Barbaren überwand dadurch, daß er einen chinesischen Namen annahm – ein Brauch, dem dann alle anderen Missionare folgten – und sich in seiner ganzen Lebensweise und
allen äußeren Gewohnheiten anpaßte, das Höflichkeitszeremoniell annahm, zunächst die Kleidung eines buddhistischen Priesters (Bonzen) anlegte, das aber bald aufgab und sich als chinesischer
Literat kleidete. Er machte sich mit den chinesischen Klassikern vertraut, nahm an Diskussionen mit anderen Literaten (z.B. in Nanking) teil, wurde in die Kreise der Literaten der einzelnen
Städte aufgenommen und gewann durch seine sanfte, freundliche Art überall persönliche Freunde und Achtung bis in die höchsten Schichten, was ihm später in Peking und bei der Bekehrung
höchster Mandarine und Angehöriger der kaiserlichen Familie sehr zustatten kam.
Dem Kaiser von China brachte er Geschenke des Herzogs Maximilian von Bayern mit, darunter auch ein Cembalo (Spinett), das er den Kaiser
zu spielen lehrte und für das er eigene Kompositionen schrieb, die heute noch erhalten sind.
Am berühmtesten in China wurde die von ihm angefertigte Weltkarte, die den Chinesen überhaupt das erste Mal einen Überblick über die
Zusammenhänge der Weltstaaten und die eigene geographische Lage als „Land der Mitte” verschaffte. Bekannt von ihm sind 27 Werke, davon die meisten in chinesischer Sprache. Berühmt ist seine Abhandlung in
Anlehnung an Cicero (in Chinesisch) „über die Freundschaft”, die ihm viele Herzen der Chinesen öffnete. Wir nennen weiter den Disput über
die Götzenlehren in China, acht chinesische Gedichte, auch als Lieder von ihm vertont, geometrische und mathematische Werke, die Kunst, das Gedächtnis zu trainieren (Mnemotechnik), Abhandlungen über die
Natur und Gott, über die zehn Widersprüche, Lehrbuch des Lateinischen in chinesischer Sprache, chinesisches Wörterbuch mit europäischer Aussprache-Bezeichnung und eine Reihe von Briefen, Seine gesamten
Werke sind in italienischer Sprache erschienen: Tacchi-Venturi, Opere storiche del P. Matteo Ricci, 2 Bände, Macerata 1911/12; P.M. D`Elia,
Fonti Ricciane, 3 Bände, Rom 1942 – 1949. Das beste in deutscher Sprache zugängliche Buch über Ricci ist das von George H. Dunne, Das große Exempel. Die Chinamission der Jesuiten, Stuttgart 1963.
[47] Es handelt sich um die Christenverfolgung, die 1664 unter der
Vormundschaftsregierung für den noch unmündigen K’ang-hsi ausbrach und deren Hauptinitiator Yang Kuang-hsien (s. dazu auch unten S. 122, Anm. 17) war. Soares streift das Ereignis kurz
in seinem Bericht (am Ende des 1. Kapitels des 1. Teils, in den Novissima-Sinica-Ausgaben von 1697 und 1699 jeweils auf S. 11 f.).
[48]Streitigkeiten zwischen den Vertretern des Papstes und den
Portugiesen. Diese Streitigkeiten gehen [zurück] auf die Teilung der Erde zwischen Spanien und Portugal seit der Entdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus und die Unterstellung der
Missionen entsprechend dieser Aufteilung auf Spanien und Portugal. Nach der Papst-Bulle von 1514 hatte Portugal das Recht des Patronats über kirchliche Einkünfte und Stellen in Afrika und
anderen Ländern, die von Portugal besetzt wurden. 1534 besetzten die Portugiesen Goa, 1557 Macao, welches noch heute unter portugiesischer Hoheit steht. Zu ihrem Einfluß- und damit
auch Missions-Bereich zählten die Portugiesen Indien und auch China. Die Ankunft der französischen Mission in China 1685 wurde von den Portugiesen als Herausforderung empfunden. Um die
Portugiesen zufriedenzustellen, unterstellte Papst Alexander VIII. die kirchlichen Diözesen Peking und Nanking der portugiesischen Kolonie Goa. Apostolische Emissäre wurden nach China vom Papst
entsandt, um aufgetretene Streitigkeiten zu schlichten.
[49] Laut Lach (a.a.O., S. 79, Anm. 34) handelt es sich
wahrscheinlich um die Reise des chinesischen Mönchs Fahsien, der 399 – 411 n.d.Z. nach Indien, Ceylon und Java reiste und mit zahlreichen buddhistischen Texten und Reliquien nach China
zurückkehrte. „Fo” ist das chinesische Wort für Buddha oder Buddhismus und wurde auch von den Jesuiten benutzt, um diese Religion zu kennzeichnen.
[50] Vertrag von Nertschinsk vom 7.9. 1689: s. ausführlich unten S.
108 ff.
 |